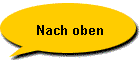Dorferneuerung geplant (nn)
Der
Ortsnamen
Hagenohe muss wohl schon sehr alt sein, wie aus dem
Ortsnamen abgeleitet werden kann, denn die Orte auf -ach sind nach Schnelbögl
älter als die auf -bach. Der ehemalige Direktor des Staatsarchivs Nürnberg
schreibt dazu: „Ungefähr seit dem Jahr 1000 scheint man ihre Bildung
nicht mehr angewandt zu haben. Seitdem wurden mehr die -bach beliebt. In unserer
Gegend stellen wir nur wenige Orte an Bächen fest, die nach der älteren, vor
der Jahrtausendwende üblichen Weise benannt sind. Es sind ... Hagenohe ... =
Ache am Hagen, d.h. Dornbusch.“ (Schnelbögl, Auerbach
in der Oberpfalz, Seite 20)
Dabei ist heute ein Bach im eigentlichen Sinne gar nicht mehr vorhanden;
lediglich der „Wassergraben“ führt das Wasser der oberhalb des Ortes
entspringenden Quelle und das Regenwasser in Richtung Ranzenthal.
Als Bischof Otto der I. der Heilige von Bamberg (1102-1139) mit der für unsere
ganze Gegend sehr bedeutenden Urkunde vom 6. Mai 1119 das Benediktinerkloster
Michelfeld gründete, wird der Ort erstmals schriftlich genannt: „Hagenach“.
In den folgenden Jahrhunderten tauchen verschiedene Schreibweisen für den
Ortsnamen auf, so z.B. 1373 und 1439 Hagena bzw. Hagenna oder 1500 Hagenoc.
1373 verkauften die Zogenreuter zu Turndorf ihre Vogtei über das Dorf Hagenohe
dem Kloster Michelfeld. Weil es ein Bamberger Lehen war, bestätigte der Bischof
von Bamberg 1373 den Verkauf, allerdings mit der Einschränkung, dass nur ein
Wappengenosse, d.h. ein Adeliger, Lehenträger im Namen des Klosters sein könne.
1385 jedoch hob der Bischof diese Beschränkung auf und gab dem Kloster die
Vogtei Hagenohe zum Eigentum. Ab 1439 gehörten dann der Zehnt und die
niedere
Gerichtsbarkeit des ganzen Dorfes „Hagenna“ zum Benediktinerkloster
Michelfeld.
Bei diesem blieb Hagenohe bis zur Klosteraufhebung im Zuge der Säkularisation
anno 1803. Bis zu diesem Jahr, also fast
vier Jahrhunderte lang, verlieh das Kloster den Bauern die einzelnen Höfe als
erbliche Lehen und verlangte dafür eine Menge von Abgaben. Solche Lasten
hatte jeder Hof, je nach Größe mehr oder weniger, zu tragen.
Feudalherrschaft
und Abgabewesen
Während der Feudalherrschaft, also ca. 788 - 1803,
gehörten die Höfe dem Feudalherrn, der sie den Bauern als erbliche Lehen überließ.
Dieses Lehenwesen brachte den einzelnen Bauern in große Abhängigkeit von
seinem Lehnsherrn und bürdete ihm eine Unmenge von Lasten auf.
In diesen über 1000 Jahre war jeder Fortschritt verpönt, und auf nahezu allen
Gebieten herrschte totale Stagnation. 1803 wurden die Felder praktisch noch
genauso bewirtschaftet, wie es Kaiser Karl der Große (768-814) in den
Capitularia angeordnet hatte. An eine wesentliche Verbesserung der Wägen und
Pflüge, der Viehrassen, der Ställe und Wohnhäuser dachte niemand, und jede
Neuerung war nahezu ausgeschlossen. 1000 Jahre lang wohnte der Bauer mit seinem
Vieh zusammen in einer hölzernen Hütte und sein Wohn- und Schlafgemach war
wenig besser, als das seiner Kühe und Ochsen.
Die Kost war ebenfalls sehr einfach und nur an den höchsten Festtagen kam
Fleisch auf den Tisch. An der Kirchweih freilich, an Fasnacht und bei Hochzeiten
ging es hoch her und es wurde im Überfluss gegessen und oft bis zur
Bewusstlosigkeit getrunken. Einfach und armselig wie die Kost war auch die
Kleidung.
Neuzirkendorf selbst kam im 13. bis 15. Jahrhundert unter die Feudalherrschaft
des Klosters Michelfeld. Vom Kloster erhielten die Bauern die Höfe als erbliche
Lehen. Als Pacht hatten sie ans Kloster verschiedene Naturalien zu liefern und
Frondienste zu leisten.
(Das Wort Frondienst kommt von mittelhochdeutsch
vron, was etwa 'herrschaftlich' bedeutet; Frondienst meint also Herrendienst.
Diesen mussten in der Feudalgesellschaft abhängige Bauern für ihren
Grundherrn leisten. F. waren Zwangsdienste zur Bewirtschaftung des
Herrenlandes durch die Pachtbauern, die erst mit der Bauernbefreiung abgeschafft
wurden, aber schon vorher oft durch Geldleistungen abgelöst werden konnten.)
Alle Höfe von mussten jährlich ans Kloster abführen:
1. den ganzen Getreidezehnt (das war
der zehnte Teil der Getreideernte)
2. den Gülthaber
3. den Hundshaber
4. an Walburgis und Michaelis kleinere Geldzinse
5. Vasnachtshennen und Herbsthennen
6. mehrere Pfund Schmalz, Käse, 1 bis 3 Schock Eier
7. Frondienste und Scharwerk mit der Hand
Einige
Höfe hatten darüber hinaus auch noch eine größere oder kleinere Gilt (die
Gilt oder Gült war eine Art Grundschuld, die durch bestimmte wiederkehrende
Abgaben zu begleichen war) ans Kloster zu liefern.
Über das mittelalterliche Abgabewesen schreibt Joseph Köstler:
„Jahrhundertlang ächzten die Bauern unter den Erpressungen des
Feudalwesens. Jeder Tag brachte neue Lasten, jede heilige Zeit schwere Abgaben.
Es waren zu liefern Vasnachtshennen, Osterlämmer und Ostereier, Walburgis- und
Michaelisgänse, Pfingst- und Weihnachtskäse, Herrenschmalz, Herbsthühner,
Hundshaber und andere Naturalien. Die Hauptlasten aber waren die Gilten und
Zehenten, Frondienste und Scharwerke. Die Bauernhöfe glichen den Bienenstöcken:
der Feudalherr nahm den größten Teil des Honigs für sich und ließ den
Arbeitsbienen nur so viel Vorräte, daß sie davon knapp und dürftig leben
konnten.“ (Köstler, Band XXII, S. 83 ff)
War das die vielgepriesene „gute alte Zeit“?
Die
Hausnamen in Hagenohe
Die Anwesen in Hagenohe tragen z.T. heute noch ihre
alten Hausnamen, deren Herkunft schon viele Jahrhunderte zurückreicht. Mancher
Einheimische muss sich sogar erst überlegen, wie sich der Nachbar denn
eigentlich „schreibt“, denn der Hausname ist im täglichen Umgang meistens viel geläufiger.
1 beim
Rupperten
2
beim Christa oder Christabauern
3
beim Reindl
4
beim Schmie
5
war das Hirthaus
6
beim Sporerkasper
7
beim Sporerfriedl
8
beim Grafn
9
beim Humer- oder Hungerbauern
10 beim
Hanser oder Haunznfriedl
11 beim
Schulbauern, der Sporerhof
12 beim Braun
13 beim Schönmann
14 beim Strölln
oder Adl
15 beim Sternecker, Wegmacher oder Kramer
Wer
mehr über die einzelnen Anwesen Hagenohes und deren Bewohner erfahren möchte:
Im Juli 1995 brachte die Pfarrei Neuzirkendorf anlässlich der Einweihung der zu
einem Gemeindezentrum umgebauten Schule ein Festbuch heraus, das in der Kirche
Neuzirkendorf zum Kauf aufliegt. Dort können u.a. die Hagenoher Höfe z. T. bis
in die Zeit des 30jährigen Krieges zurückverfolgt werden.
In
den Jahren 1969 bis 1979 wurde in Hagenohe die Flurbereinigung durchgeführt, in
deren Zuge auch die gemeindliche „Marksteinhalle“ errichtet wurde. In
ihr findet seit einigen Jahren das traditionelle „Gurkenfest“ der
Freiwilligen Feuerwehr Ranzenthal statt, die der einzige Verein der Ortschaft
ist. Doch die Tage der "Gurkenhalle" sind gezählt. (nn)

Das
große Kreuz in der Ortsmitte wurde vor einigen Jahren erneuert.

letzte
Bearbeitung dieses Artikels am 14. Dezember 2018