|
| |
Der Schlaggenwalder Heimat- und
Geschichtsverein e.V.
mit Sitz in Auerbach i.d.OPf.
wurde zum 1.1.2009 aufgelöst
und im Vereinsregister gelöscht.

2006
jährte sich zum 50. Mal
die Übernahme der Patenschaft
durch die Stadt Auerbach
über die
aus ihrer Egerländer Heimat
vertriebenen
Schlaggenwalder.
Höhepunkte der Jubiläumsfeierlichkeiten
waren der Heimatabend mit Grußworten und der Vorstellung der von mir, dem Betreiber dieser
Website, erstellten Festschrift am Samstag (2. September 2006) sowie die Enthüllung der erneuerten Gedenktafel am Auerbacher
Rathaus am
Sonntag (3. September 2006).


Schlaggenwald
und die Schlaggenwalder
Nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges und nach der rechtswidrigen Vertreibung aus
ihrer angestammten Heimat kamen zahlreiche Heimatvertriebene auch nach Auerbach
in der Oberpfalz und sorgten hier mit dafür, dass es in unserer Stadt wieder aufwärts ging.
Unter diesen, im Volksmund fälschlicherweise „Flüchtlinge“ genannten,
befanden sich auch mehrere Bewohner der Stadt Schlaggenwald im Egerland.
(gute Seite über das
Egerland!)
Schlaggenwald
(Kreis
Elbogen)
liegt etwa 15 km südwestlich von
Karlsbad in einem Talkessel des
erst 1974 geschaffenen
Naturschutzgebietes
Kaiserwald.
 |
Das 1877-78 durch den Fürsten
Otto von Schönburg-Waldenburg
im Stile von Schweizer Jagdhütten
erbaute Jagdschloss Kladska
im
Kaiserwald wird heute
als Hotel
betrieben und ist
Ausgangspunkt
zahlreicher Ausflüge. |
Eigentlich muss es
ja heißen, „Schlaggenwald lag dort“, denn seit 1945 gibt es
dieses urdeutsche Städtchen in seiner damaligen Form nicht mehr. Die meisten
der damaligen Bewohner - 1939 waren es 3.026 - wurden aus ihrer angestammten Heimat vertrieben, und Tschechen, die
neuen Herren, haben das Gesicht dieses einstmals schmucken Städtchens
grundlegend verändert; Horni Slavkov heißt der Ort heute. Näheres aus der
Geschichte von Schlaggenwald findet man weiter unten.

Erinnerungen
werden sicher wach beim Anblick dieser Ansichtskarte, die den unteren Marktplatz
des ehemaligen Schlaggenwald mit der Spitalkirche St. Anna vor etwa 60 Jahren
zeigt.
Die
Übernahme der Patenschaft über die Schlaggenwalder durch die Stadt Auerbach
ist nun bereits über ein halbes Jahrhundert her. Im Rahmen einer großen
Feierstunde im (1995 abgebrochenen)
Pfarrsaal beim Caritasheim (heute
Alten- und Pflegeheim St. Hedwig) anlässlich des 6. Wiedersehensfestes am Samstag, den 11. August 1956, übergab
der damalige 1. Bürgermeister Fritz Finsterer an die Bürger von Schlaggenwald
eine Urkunde. In ihr ist der Beschluss des Auerbacher Stadtrates vom 19. Januar
1956 dokumentiert, in welchem dieser „einstimmig beschlossen“ hat, „die
Patenschaft über die sudetendeutsche Bergstadt Schlaggenwald zu übernehmen“.
In
diesem „Patenbrief der Stadt Auerbach an die Bürgerschaft der Stadt
Schlaggenwald“ heißt es weiterhin: „Die Bürger der beiden Bergstädte
werden für alle Zukunft bemüht sein, in inniger Freundschaft immer mehr
zusammenzuwachsen ... .“ (1) Diesem Ziel dienen auch die bisher nahezu jedes Jahr
in Auerbach durchgeführten „Schlaggenwalder Heimattreffen“.
Blick in die reiche Vergangenheit von
Schlaggenwald
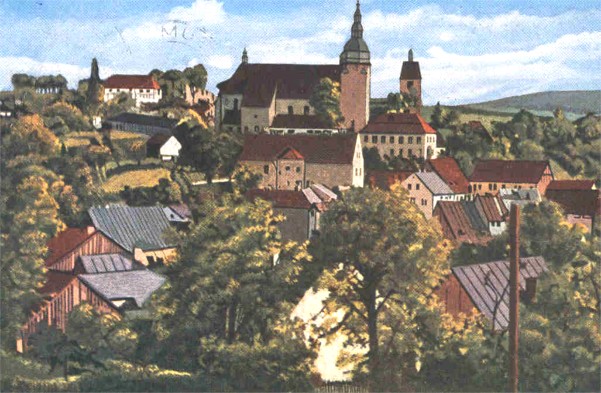
So wie bei Auerbach liegen auch bei Schlaggenwald die geschichtlichen Anfänge
im Dunkel der Zeit. Zahlreiche Bodenschätze, wie z.B. vor allem Zinnerze, aber
auch Blei, Kobalt, Kupfer, Silber, Uran und andere Metalle waren sicher ein
Grund dafür, dass in diesem Gebiet bereits in vorchristlicher Zeit Kelten
siedelten; u. a. alte Opfersteine auf dem Spitzberg bezeugen dies. Fest steht
wohl, dass im Jahrtausend vor Christi Geburt der keltische Stamm der Bojer in
diesem Gebiet siedelte. Die Namen „Böhmen“ und „Bayern“ gehen auf
dieses Volk zurück. Unter dem Druck der Awaren, einem mit den Hunnen verwandten
Volksstamm, drangen dann später im 6. Jahrhundert n. Chr. slawische Stämme in Böhmen
ein. Etwa im 12. Jahrhundert „begann die Umwandlung des Waldgebietes in eine
blühende Kulturlandschaft. Bergbau, Handel und Wandel brachten nach und nach
verschiedene Stämme, wie Bajuwaren, Franken, Thüringer usw. in unser Gebiet.
Die Siedler bekannten sich zum christlichen Glauben. Dies traf vermutlich auch
auf die bereits ansässige Bevölkerung zu.“ (2) Wahrscheinlich wurde die
ganze Gegend vom Kloster Tepl
aus missioniert und betreut.
In die geschriebene Geschichte tritt Schlaggenwald etwa zwei Jahrhunderte später
als Auerbach um das Jahr 1202 ein; in diesem Jahr wird in einer Urkunde
jedenfalls der Ortsname erstmals genannt. Der gesamte Kaiserwald mit den späteren
Bergstädten Schlaggenwald, Schönfeld und Lauterbach gehörte damals den Herren
von der Riesenburg. Ein Slawko oder Schlakko aus diesem Geschlecht ließ im
Waldgebiet Krudum nach Erz graben. Bald entstand ein Dorf, das nach seinem Gründer
„Schlakkowald“ genannt wurde; die Ansiedlung Seifahrtsgrün bestand wohl
schon früher. Der große Erzreichtum lockte viele Menschen aus dem benachbarten
Bayern, aus Sachsen und aus dem Harz an, die im Bergbau Arbeit und Brot und im
Schlaggenwalder Gebiet eine neue Heimat fanden. (Sagen
und Bräuche)
Stadterhebung
1300 n.Chr.
Schlaggenwald, das insbesondere durch die Gewinnung und Verarbeitung von
Zinn rasch an Bedeutung gewonnen hatte, wurde wahrscheinlich schon im Jahre
1300, also 14 Jahre vor Auerbach, zur Stadt erhoben. Aber ähnlich wie bei
Auerbach liegt leider keine genau datierte Urkunde über dieses Ereignis vor.
1383 jedenfalls „hängte der Herr von Gfell an eine Urkunde das Siegel der
Stadt zum Schlakkenwalde“. (2)
|

|
Das historische
Schlaggenwalder Stadtwappen
erinnert an den hier
über Jahrhunderte
betriebenen Bergbau.
|
So wie in die Oberpfalz fielen die Anhänger des tschechischen Reformators Jan
Hus, der 1415 auf dem Konzil von Konstanz verbrannt worden war, auch in die
Schlaggenwalder Gegend ein. Fazit der Hussitenkriege (1419-36): „Bergbau,
Gewerbe und Handel kamen nahezu ganz zum Erliegen. Das Gemeinwesen brauchte
Jahrzehnte, um sich wieder zu erholen.“ (2)
Die
Pfluge von Rabenstein
Nachfolger derer von der Riesenburg als Herren des Ortes waren die Grafen
von Gleichen, die Junker von Plauen und Meißen, die Grafen von Schlick und
schließlich ab 1494 die Pfluge von Rabenstein (Pflugk von Rabstein, tschechisch
Pluhové z Rabštejna). Ihr Wappen, u.a. mit zwei silbernen Pflugscharen,
ist unten zu sehen.
|

|
Die
Pfluge "waren ein altes böhmisches Wladika-Geschlecht,
das im 15. Jhdt. zum
Adelstand erhoben wurde.
Hanuš, der der höchste Kanzler
von Königreich
Böhmen (1533-1537) war,
hat den Bergbau unterstützt und dank der Erträge
aus dem Bergbau hat er zu den reichsten Herren
in Böhmen gehört. Sein
Neffe Kašpar
hat die hohe Stellung und auch den Besitz geerbt
und hat die
Bauten in Petschau
vermehrt.
Nach der Niederlage des Ständeaufstandes
hat er alles verloren,
er hat sich das Leben
durch die Flucht nach Meissen gerettet.
Nach der
erlaubten Rückkehr ist er 1583 gestorben
und mit ihm ist der böhmische
Geschlechtszweig
ausgestorben." (Quelle) |
Gerade
diese Pfluge von Rabenstein erwarben sich
große Verdienste um Schlaggenwald und dessen Bergbau, indem sie z.B. einen 100 tiefen
Wasserstollen, den sog. „Kaspar-Pflug-Erbstollen“ errichten ließen, der die
Erzgruben wasserfrei hielt.
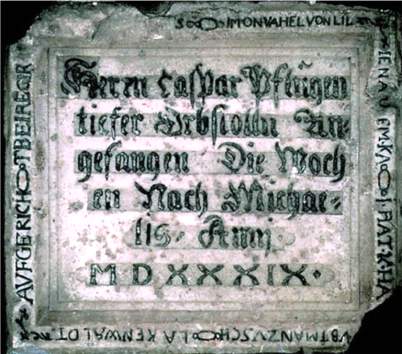 |
Im
heutigen Heimatmuseum
in Schlaggenwald befindet sich
u. a. auch die original Eingangstafel
(1539) zum ehemaligen
Kaspar-Pflug-Erbstollen. |
Ein weit angelegtes Kanalsystem, das zum Teil noch
vor dem Krieg in Betrieb war, sorgte für die Versorgung mit Trinkwasser. Viele
stattliche Häuser im Nürnberger Baustil, die sog. „Pflughäuser“, verkündeten
der Nachwelt vom Wirken dieses Geschlechtes.

In
seinen Grundzügen stammte das Rathaus von Schlaggenwald aus dem 16.
Jahrhundert. Leider fiel das prächtige historische Gebäude Mitte der achtziger
Jahre des 20. Jahrhunderts einem mysteriösen Brand zum Opfer.
Bereits vor der Vertreibung war rechts in den ehemaligen Räumen der Sparkasse
ein von Bürgerschulrektor Prosch betreutes Heimatmuseum untergebracht. Auch die
Gaststätte links gab es nicht mehr.
In
diese Zeit fällt 1518 auch die Geburt des vielleicht bedeutendsten Sohnes der
Stadt Schlaggenwald, nämlich des Caspar
Bruschius,
der sich als Autor, Geschichtsschreiber, Poeta laureatus, Humanist und Anhänger
der Reformation einen Namen machte.
In den Glaubenswirren der
Reformationszeit mussten die Pflug 1547 Schlaggenwald in Richtung Sachsen
verlassen. Hausfassaden um den ehemaligen Marktplatz der Stadt erinnern noch an
sie. Der spätere Kaiser
Ferdinand
I. beschlagnahmte als römisch-deutscher König sämtliche Pflug'schen Güter und erklärte
Schlaggenwald im gleichen Jahr 1547 zur „kaiserlich freien Bergstadt“.

Ferdinand I.
(1503-1567)
aus dem Geschlecht der
Habsburger
war von 1558 bis 1564
Kaiser des
Heiligen Römischen Reiches.
Ab 1521 war er als
Erzherzog von Österreich Herrscher in den
habsburgischen Erblanden und ab 1526/1527
König von Böhmen,
Kroatien und
Ungarn. Bereits zu Lebzeiten seines Bruders, des Kaisers
Karl V., wurde er 1531 zum
römisch-deutschen König gewählt und war der letzte deutsche König,
der in
Aachen gekrönt wurde.
Reformation
und Gegenreformation
 |
Die frühen Christen errichteten wahrscheinlich
auf einer kleinen Anhöhe in Seifahrtsgrün
eine St. Anna-Kapelle als erstes Gotteshaus in Schlaggenwald.
Wie
bei unserem Auerbach war auch in Schlaggenwald
mit der Markt- bzw. Stadterhebung die Errichtung
einer selbständigen Pfarrei verbunden.
Die St. Georgskirche, heute leider in
einem erbärmlichen Zustand,
war von Anfang an Pfarrkirche. (3) |
 |
Etwa zur selben Zeit wie in Auerbach
wurde auch in Schlaggenwald um 1530
die
neue Lehre Martin Luthers eingeführt.
In der 1525
fertig gestellten neuen St. Georgskirche
wurden evangelische Gottesdienste abgehalten,
in der Spitalkirche
St. Anna (siehe
historisches Foto)
zeitweise noch katholische. |
Nach der Schlacht
am Weißen Berg 1620 und der Flucht des „Winterkönigs“
Friedrich V. (er hatte am 21. Juni 1621 mit seiner Gattin Elisabeth in Auerbach
zur Huldigung geweilt) kam Schlaggenwald unter kaiserlichen Schutz; damit begann
die Rückführung zum katholischen Bekenntnis. 1624 musste der letzte
evangelische Pfarrer Paul Ratenstein die Stadt verlassen, in Auerbach widerfuhr
zwei Jahre später dem Peter Reiß das gleiche Schicksal. Im Verlauf dieser
Rekatholisierung verließen in beiden Städten so manche Bürger ihren
Heimatort.
Schlaggenwald war wieder katholisch geworden; bei der Vertreibung nach dem II.
Weltkrieg gehörten von den rund 5.000 Einwohnern (einschließlich der Dörfer)
über 90 % diesem Bekenntnis an.

So haben die Schlaggenwalder
ihre St. Georgskirche
in Erinnerung.
Die
nächsten drei Jahrhunderte
Für die folgenden Jahrhunderte sollen einige wichtige Ereignisse chronologisch
aufgeführt werden. (2)
1688 wurde die erste Feuerspritze angeschafft. Beim großen Brand 1713 fielen 76
Häuser den Flammen zum Opfer, dazu auch die St. Annakirche und das Spital.
1742 im Verlauf des Krieges um die Erbfolge in den habsburgischen Ländern
(1740-48, sog. Österreichischer
Erbfolgekrieg) besetzten Franzosen
Schlaggenwald. Nach Kriegsende begann Maria
Theresia, Erzherzogin von Österreich
(1740-80) und Königin von Böhmen und Ungarn, die Verwaltung des Habsburger
Reiches neu zu ordnen. Schlaggenwald kam nun zum Kreisamt Elbogen.
1774 waren im Bergbau nur mehr ca. 200 Arbeiter beschäftigt.
|

|
1792 gilt als Gründungsjahr der ersten
Porzellanfabrik in
Schlaggenwald. 1867 nach der Übernahme durch die Vettern Haas
und Czjzek
hieß die Porzellanfabrik
Haas & Czjzek.
Bis herauf in unsere Tage produzierte sie wertvolles
Porzellan.
Links ein Beispiel für das berühmte Schlaggenwalder Porzellan.
Seit 1988 war die traditionsreiche
Firma
Teil des staatlichen Betriebs Karlsbader Porzellan.
(Ende?) |
 |
1909 ließ der Lederfabrikant Roßmeissl eine Dampfkraftanlage bauen, die auch
der Stromerzeugung diente.
Am Ende der ersten Weltkrieges (1914-18) zählte Schlaggenwald 3.305 Einwohner,
darunter 39 Tschechen. Das Sudetenland wurde der neugegründeten
Tschechoslowakei eingegliedert, auch die Schlaggenwalder erhielten durch einen
Verwaltungsakt statt der österreichisch-ungarischen die tschechische Staatsbürgerschaft,
die sie bis 1938 behielten. Bei den staatlichen Verwaltungen (Bahn, Post,
Gendarmerie) wurden nun die deutschen durch tschechische Bedienstete ersetzt.
Deutsch blieb Amts- und Unterrichtssprache, amtliche Vordrucke lagen
zweisprachig auf.
„Im Juni 1919 fand die erste Gemeinderatswahl statt. Lebenserfahrene Männer
nahmen die Geschicke der Stadt in die Hand. Die Einwohner waren zum größten
Teil in den Porzellanfabriken und in der Lederfabrik beschäftigt. Ein kleiner
Teil lebte von Gewerbe und Landwirtschaft.“ (2)
„Getragen vom politischen Umschwung in Deutschland (1933), getrieben von der
schlechten materiellen Lage vieler Menschen und dem uneinsichtigen Verhalten der
Prager Regierung, fand die Sammlungsbewegung Henleins unter den Sudetendeutschen
regen Anklang. Sie formierte sich ab 1934 zunächst als Sudetendeutsche
Heimatfront und dann als Sudetendeutsche Partei (SdP).“ (2)
Nach dem Stufenplan des Münchner
Abkommens erreichten am 4. Oktober 1938
deutsche Wehrmachtsverbände Schlaggenwald, wo sie von der Bevölkerung stürmisch
begrüßt wurden. „Schlaggenwald gehörte 1938-1945 zum Deutschen Reich. Die
2.950 Einwohner der Stadt waren nun deutsche Staatsbürger geworden.“ (2)
II.
Weltkrieg und
Vertreibung
|
Die Geschichte der „letzten Jahre Schlaggenwalds“
sind im Zusammenhang
dem 1991 erschienen Buch
„Schlaggenwald - einst kaiserlich freie Bergstadt im
Egerland“
(2) entnommen.
Dieses nicht nur für die Patenkinder Auerbachs
einmalige
Werk wurde vom
"Schlaggenwalder Heimat- und Geschichtsverein"
unter seinem
(damaligen) sehr rührigen
Vorsitzenden
Josef Tauber (Tauber Seff) herausgegeben. |
 |
„Ab 1939 wurden die kriegsdiensttauglichen Männer jahrgangsweise zum Militär
eingezogen, es sei denn, sie waren wegen ihrer Tätigkeit als unabkömmlich (uk)
eingestuft. Manche mussten in kriegswichtigen Betrieben arbeiten. Immer mehr
nahmen dienstverpflichtete Frauen die Arbeitsplätze einberufener Männer ein.
Um fehlende Arbeitskräfte zu ersetzen, mussten ganze Schulklassen Ernteeinsätze
und Mädchen nach dem Schulabgang ein Pflichtjahr in der Landwirtschaft, bei
kinderreichen Familien oder bei Sozialdiensten leisten. Jungen und Mädchen (ab
17) arbeiteten beim Reichsarbeitsdienst (RAD) in der Landwirtschaft, beim Wege-
und Straßenbau, Urbarmachen brachliegender Böden usw..
Schlaggenwald war bis zum Sommer 1944 vom Kriegsgeschehen nicht unmittelbar
betroffen und auch von Luftangriffen unbehelligt geblieben. Die Fronten rückten
indessen näher. Nachrichten über gefallene und vermisste Mitbürger brachten
immer wieder großes Leid über viele Familien. Der zunehmenden Bedrohung aus
der Luft suchte man durch Anlegen von Schutzräumen (Felsenkellern) und
Einhalten der Verdunkelung zu begegnen. Nach dem missglückten Anschlag auf
Hitler am 20. Juli 1944 ließen jedoch die Bombardierung von
Karlsbad am helllichten
Tag und gelegentliche Tiefflugangriffe amerikanischer Jabos (Jagdbomber) in
unserer näheren Umgebung - selbst einzelne Lkw oder Fuhrwerke waren vor ihnen
nicht sicher - erkennen, dass die alliierten Geschwader auch den Luftraum über
uns beherrschten.
Im Jänner (Januar) 1945 rückten 20 ältere Männer zum Volkssturm ein. Zur
gleichen Zeit traf ein Eisenbahnzug mit Zivilpersonen aus Ungarn ein. Sie fanden
in Gebäuden der Porzellanfabrik H. & C. Aufnahme. Auch die ersten Flüchtlinge
aus Schlesien kamen an, die vor den anrückenden Sowjettruppen fliehen mussten.
Im Feber (Februar) erging Anordnung, auch die Hitlerjugend (14-16jährige Buben)
in Aufgaben der Landesverteidigung einzubeziehen.
Ein großer Transport mit Flüchtlingen aus der Breslauer Gegend und aus Danzig
wurde der Stadt zugewiesen. Sie mussten in Privathaushalten untergebracht
werden.
Im März stellten die Schulen wegen häufiger Fliegeralarme den Unterricht ein.
Anfang April erreichte ein Flüchtlingstreck mit 20 Wagen aus Oberschlesien
unseren Ort.
Wie anderswo auch, errichtete man an den Zufahrtsstraßen Panzersperren aus
dicken Holzstämmen.
Gegen Ende des Monats passierten Einheiten der Wehrmacht mit Fahrzeugen und
schwerem Kriegsgerät unsere Gegend in Richtung Osten. Sie kehrten nach wenigen
Tagen zurück und blieben in der Stadt. Vernünftigen Offizieren gelang es, eine
Rundumverteidigung von Schlaggenwald zu verhindern. (Dass dies bereits im
Mittelalter nicht möglich war, beweist das Fehlen von Stadtmauern, Wehrtürmen
und sonstigen Befestigungsanlagen.)
Am 7. Mai drangen überraschend amerikanische Truppen von der Oberen Gasse her
kampflos in das Stadtgebiet ein. Sie hatten sich von Falkenau aus durch die Wälder
unbemerkt genähert und so die Sperren umgangen. Unsere Soldaten leisteten
keinen Widerstand und ließen sich entwaffnen. Unsere Stadt blieb unversehrt.
Mit der Kapitulation des Deutschen Reiches war der Zweite Weltkrieg zu Ende.
Hier endet auch offiziell die Geschichte des deutschen Ortes Schlaggenwald, der
fortan wieder Horni Slavkov hieß.“ (2)
Am 16. März 1946 begann dann offiziell die Vertreibung der deutschen Bewohner.
Die Schlaggenwalder wurden in den folgenden Wochen quasi in alle vier Winde
zerstreut, ein Jahrzehnt später übernahm unser Auerbach die Patenschaft über
sie.
„Wanderer,
kommst Du nach Horni Slavkov,
dann bleibt Dir fast das Herz stehen.
Der Anblick
unserer Heimatstadt,
der Verfall von vertrauten Gebäuden,
das Fehlen ganzer
Gassen,
die Überwucherung durch Unkraut
und die Unordnung allenthalben
machen
betroffen und fassungslos.
Unser altes Schlaggenwald
hat sein Gesicht
verloren.“ (2)

So oder ähnlich
dachte bestimmt auch Franz Hofmann,
als er 1991 nach rund einem halben Jahrhundert
zusammen mit dem
Verfassers dieses Artikels
erstmals wieder seine Geburtsstadt
sah und betrat.
Franz Hofmann (+2012)
war zusammen mit seinem Vater Anton
und mit Toni Kunzmann
der Auerbacher Motor
der Schlaggenwalder
Heimattreffen.
(Das Foto zeigt Franz Hofmann in tiefer Erschütterung
vor dem
Kriegerdenkmal
auf dem damals sehr verwahrlosten Friedhof um die St. Georgskirche.)


Schlaggenwald heute
(Foto
Jiri Laubendorf/Petr Lauer)

verwendete und weiterführende Quellen
| 1 |
Patenbrief der Stadt Auerbach an die Bürgerschaft der Stadt Schlaggenwald,
gegeben am 11. August 1956 von Bürgermeister und
Stadtrat, Lagerort Rathaus Auerbach |
| 2 |
Schlaggenwald, einst kaiserlich freie Bergstadt im Egerland, Hausham 1991
(Schlaggenwalder Heimatbuch; eventuell in Antiquariaten noch erhältlich) |
| 3 |
Jakob
Herbert/Dilling Heinrich, Schlaggenwald - St. Georg, eine Kirche in
Böhmen, Schlaggenwalder Heimat- und Geschichtsverein, 2001 |
| 4 |
https://www.online-ofb.de/schlaggenwald/ |
letzte
Bearbeitung dieses Artikels am 17. April 2024

|
Ich selbst bin kein Schlaggenwalder,
sondern ein "echter" Auerbacher.
Diesen Artikel habe ich verfasst,
weil ich die Aufbauarbeit der Heimatvertriebenen
nach dem Krieg hier bei uns sehr schätze,
weil meine Heimatstadt Pate für die
aus ihrer Heimat vertriebenen Schlaggenwalder ist,
und weil ich unter den ehemaligen Schlaggenwaldern
mittlerweile viele Freunde gewinnen durfte.
|

|
Für Ergänzungen, Korrekturen usw.
bin ich sehr dankbar.
Hier können Sie mich erreichen!
 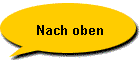 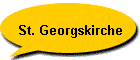   |