|
| |
Burg Huwenstein
oder Gernote(n)stein
Von ihrer Existenz ist das bis dato bekannte
erste schriftliche Zeugnis die Gründungsurkunde des Klosters Michelfeld vom 6.
Mai 1119.
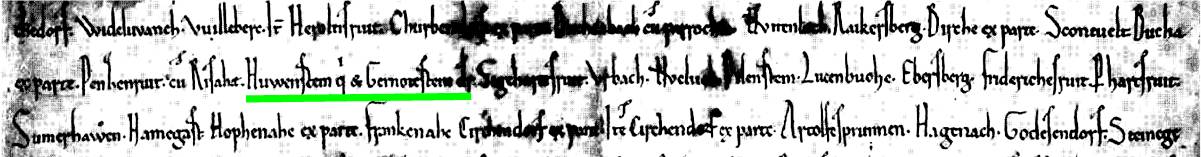
In der Reihe der zahlreichen Stiftungsgüter steht "Huwenstein,
qui et Gernotestein dicitur" (1, Seite 298), zu deutsch "Huwenstein, das auch
Gernotestein genannt wird". In dieser wichtigen Urkunde wird zwar nicht ausdrücklich von einer
Burg Huwenstein gesprochen, aber mit "stein" bezeichnete man vor 1200 Burgen
allgemein, eben weil diese aus Stein gebaut waren im Gegensatz zu den normalen
Häusern, die damals meistens aus Holz waren. "huwe" nannte man in
jener Zeit den Uhu bzw. jede Eule, so dass Huwenstein die Steinburg war, wo Uhus
nisteten. Der zweite, wohl jüngere Name Gernote(n)stein bedeutete Steinburg eines
gewissen Gernot.
Im nächsten bekannten Zeugnis von Huwenstein, der "relatio de piis operibus Ottonis
episcopi Bambergensis" (Liste der frommen Werke des Bischofs Otto von
Bamberg, verfasst vermutlich zwischen 1139 und 1147 in Bamberg vom Michelsberger
Propst Thiemo), wird deutlich und ausdrücklich von "castellum, quod
dicitur Gernotestein" geschrieben; castellum heißt deutsch Burg. (2)
Von Helmut Kunstmann stammt ein sehr interessanter Artikel (3), der u. a. hier
mit eingeflossen ist.
Der Standort der
verschwundenen Burg
ist wohl nicht ganz gesichert. Erich v. Guttenberg vermutete sie auf dem
Breitenstein, einem Höhenzug südlich von Penzenreuth, knapp 4 km nordwestlich
von Michelfeld im Gebiet der Stadt Pegnitz gelegen. (2) Dem widerspricht Heinrich
Bauer: "Auf dem Breitenstein, einem langgestreckten Höhenzug südlich von
Penzenreuth ... kann jener Sitz nicht gestanden haben, da dort keine Spur einer
ehemaligen Bebauung zu finden ist und es auch ringsum geeignetere Höhen für
eine Felsburg gab. Eher wäre an den Burgstall bei Hainbronn zu denken; von
Resten einer einstigen Niederlassung ist aber auch dort nichts zu sehen."
(4, Seite 67)
"Meine ursprüngliche Vermutung, daß die
Burg Hollenberg bei Pegnitz die frühere Burg Huwenstein gewesen sein könnte,
scheiterte an dem Fehlen romanischer Keramikfunde trotz ausgedehnter
Nachforschung in den Schutthalden der Ruine. Der Name Ober- und Unterhauenstein
im Püttlachtal unterhalb der Ruine Hollenberg und die Tatsache, daß die dort
befindliche vormalige Mühle „auf das Haus - d. h. die Burg Hollenberg –
diente“, wie es im neuböhmischen Salbüchlein heißt, ließen einen
Zusammenhang zwischen der Burg Huwenstein und dem Hollenberg möglich
erscheinen. Hauenstein ist nämlich die sprachliche Weiterbildung von Huwenstein.
In einem Aufsatz in den Fränkischen Blättern im Jahre 1958 machte ich auf eine
weitere Möglichkeit aufmerksam. Unmittelbar an den Burgstall Moschendorf, der
nach den Keramikresten auf das 11. Jahrhundert zurückgeht, grenzt im Südosten
eine Flur, die den Namen Hauenstein trägt. Der Burgstall in Moschendorf selbst
läßt seiner Anlage nach ebenfalls auf ein hohes Alter schließen, ebenso wie
die Siedlung Moschendorf, deren Gründung etwa um 800 anzusetzen ist, nachdem es
sich um einen Ortsnamen mit der Zusammensetzung Personennamen und -dorf handelt.
Diese letzte Deutung über die mögliche Lage der Burg Huwenstein hatte bei der
damaligen Kenntnis der urkundlichen Überlieferung auch die größte
Wahrscheinlichkeit für sich." (3, Seite 61 f)
Die erste Nennung von Burg Huwenstein in der Gründungsurkunde von Kloster
Michelfeld weist nicht direkt auf einen Standort hin, aber ihr Name wird
aufgezählt nach Penzenreuth mit Reisach und vor Sigehartisruit und Auerbach.
Dieses Sigehartisruit könnte nach Schnelbögl Saaß oder Reichenbach (1, Seite
34) sein; wenn dies so wäre, müsste Burg Huwenstein sehr nahe bei Michelfeld
gestanden sein.
Letzteres bestätigt auch ein Literale aus dem 18. Jahrhundert mit Abschriften
aus dem Kopialbuch des Michelfelder Abts Heinrich von Truppach (1406-36). Darin
heißt es in deutscher Übersetzung unter der Überschrift "Bemerkens- und
Wissenswertes über die Verhältnisse des Klosters und die Zerstörung der Burg
Huwenstein": "Als der gottseelige Otto sah, dass diese Veste dem
Kloster bedrohlich würde, erwog er, dass es entweder zweifelsohne notwendig
sei, die Burg zu zerstören oder es wäre die für die Gründung des darunter
liegenden Klosters (subteriacentis monasterii) aufgewandte Mühe umsonst. Daher
übergab er, durch eine göttliche Eingebung ermahnt, die gesamten Festungswerke
des Ortes dem Feuer, nachdem vorher die Reliquien aus der Kapelle St. Nikolaus
am gleichen Ort (de basilica beati Nicolai in loco eodem) entfernt worden waren.
Bischof Otto bestattete sie nachher in einer dem heiligen Nikolaus geweihten
Kirche bei Michelfeld mit der den Reliquien schuldigen Ehrerbietung. Die
Felsenburg (arcem lapidis) sollte auf ewig zerstört bleiben und der Versuch
eines Wiederaufbaues mit ewiger Verdammnis belegt werden." (3, Seite 63)
Diese Quelle bekräftigt die Annahme, dass Gernotestein sehr nahe beim Kloster
bzw. oberhalb von diesem gestanden haben muss. Weiterhin geht daraus hervor,
dass es sich um eine auf einem Felsen stehende Burg gehandelt hat. "Die Untersuchung
aller in Frage kommenden Höhen in der Umgebung des Klosters Michelfeld ergab
eindeutig, daß nur die Felsnase nördlich des Klosterfriedhofs als Stelle der
Burg Huwen- oder Gernotenstein in Betracht zu ziehen ist. Sie war durch
Steilabsturz im Norden und Westen in das Tal des Flembachs geschützt. Sie
Südseite, die etwas sanfter gegen das Gelände des heutigen Klosterfriedhofs
abfällt, war trotzdem noch zur Verteidigung geeignet genug. Nach Osten zu
sichert eine Geländestufe die ehemalige Burg vor einem Angriff.
Eine Furche, die noch deutlich am Nord- bzw. Südrand vor der westlichen
Felsspitze zu erkennen ist, könnte die Stelle eines ehemaligen Grabens zwischen
Vor- und Hauptburg gewesen sein. Am Nordrand ist sie noch als in Fels gehauener
Graben von 10 m Breite und 1,5 m Tiefe anzusprechen. Der Graben trennte Vor- und
Hauptburg. Die Vorburg war 45 m lang und etwa 20 m breit. Die Hauptburg war 24 m
lang und endete mit einer 5-6 m breiten Felsspitze im Westen.
Mehrere Bodenvertiefungen deuten möglicherweise den Platz ehemaliger Gebäude
an. Am nördlichen Felshang findet sich eine nach Norden offene Höhle, zu der
ein schmaler Pfad von Osten herführt. Ihr Zugang war in jüngster Zeit durch
eine Türe verschlossen, wie der ausgehauene Türfalz und die Pfostenlöcher für
den Türsturz im Fels beweisen. Der Zugang war außerdem nach oben zu durch
Deckplatten verschlossen.
 |
Unmittelbar vor dem zur Höhle führenden Pfad zeigt
der Burgfels eine Felsbearbeitung in Form einer rundbogigen Doppelnische. Die
Konturen dieser Nischen sind durch Verwitterung ausgewaschen, was für ihr hohes
Alter spricht. Besonders deutlich ist die Verwitterung am oberen Abschluss zu
erkennen.
|
Vergleichen wir hierzu die neuere Felsbearbeitung am Eingang zur Höhle,
so wird uns dieser Unterschied ganz offenkundig. Diese Doppelnische wird der früheren
Burgkapelle zuzuschreiben sein." (3, Seite 63 ff)
Gewiss ist, dass Burg
Huwen-
oder Gernotestein existiert
hat. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege
(BlfD)
sagt dazu und bringt einen weiteren Aspekt ins Spiel: "Mittelalterlicher
Burgstall Huwenstein/Gernotestein mit der Höhle Guckerloch (A 44), vielleicht
eine Höhlenkirche."
Das Guckerloch, in unserem Dialekt Guggerluch, ist eine Höhle
im Burgstall der ehemaligen Burg Huwenstein
oder Gernote(n)stein. Auf der Karte des BayernAtlas ist er als
Guggerlochfels
bezeichnet.
verwendete und weiterführende Quellen
| 1 |
Schnelbögl, Dr. Fritz, Auerbach in der
Oberpfalz
Herausgeber Stadt Auerbach, 1976 |
| 2 |
Guttenberg, Erich Freiherr von, Die Territorienbildung am Obermain, in Band 79 des Historischen Vereins zu
Bamberg, 1926, S. 154, Anm. 257 |
| 3 |
Kunstmann, Helmut, Die verschwundene Burg Huwen- oder Gernotenstein bei Michelfeld, in Altnürnberger Landschaft,
Mitteilungen, Juni 1964 |
| 4 |
Bauer, Heinrich, Geschichte der Stadt Pegnitz
und des Pegnitzer Bezirks, Pegnitz 1938 |
| 5 |
Schraml, Walter, Steinerne Zeit-Zeugen -
Geheimnisvoller Burgstall beim Kloster Michelfeld gibt Rätsel auf, in
Sulzbach-Rosenberger-Zeitung, Ausgabe Auerbach, 30. Dezember 2011 |
| |
Schraml, Walter, Die
geheimnisumwitterte Burg Huwen- oder Gernotenstein bei Michelfeld, in Der
Eisengau, Band 40/2013, Amberg 2013 (Seite 118ff) |
| |
Buchfelder, Else, Burg Gernotenstein
durch Feuer vernichtet, in Der neue Tag, 5.4.1989 |
| |
http://www.wikiwand.com/de/Burgstall_Gernotenstein |

An der Vervollständigung
dieses Artikels
arbeite ich gerade.

Über mir kurzzeitig zur
Verfügung gestellte
Fotos und Informationen
über die Burg Huwen- oder Gernotestein
bei Michelfeld
würde ich mich sehr freuen.
Bitte etwas Geduld.
letzte Bearbeitung dieses Artikels am 13. Juli
2018

 |
Wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen möchten,
können Sie mich hier
erreichen
oder telefonisch unter 09643 683.
|
 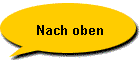
|