|
| |

Reichenbach
Das
kleine Dörfchen Reichenbach (zum 1.1.2005 genau 35
Bewohner; zum 1.6.2018 waren es 30) gehört seit dem 1. Mai 1978 zusammen mit den
anderen Orten Degelsdorf und Zogenreuth der bis dahin selbständigen politischen
Gemeinde Degelsdorf zur Stadt Auerbach. (Foto 2005) Bis 1946 hatte das Dorf zur
Gemeinde Steinamwasser gehört; aus diesem Grund trägt die Gemarkung heute noch
diesen Namen.
Das heutige Reichenbach, im Dialekt Reichabooch,
liegt a. 2 km nördlich des Rathauses von Auerbach.
Im Zuge der Aufschließung des Eisenerzbergwerks
Leonie wurde etwa ab 1975 ein großer Teil der Anwesen von Reichenbach abgelöst
und umgesiedelt. Heute gehören diese Grundstücke überwiegend zum Naturschutzgebiet
Grubenfelder Leonie.
 |
Wie
die meisten Anwesen
der Ortschaft Reichenbach
dem Erdboden gleich gemacht
wurden,
so musste auch die Straße,
die von der ehemaligen B 470
(etwa
die Trasse des heutigen Rad-
und Fußweges zwischen
Auerbach und
Degelsdorf) abzweigte,
dem Bergbau weichen.
Das Foto (2005) zeigt den Rest der Abzweigung
von der alten Bundesstraße 470,
zu sehen bei der Unterführung
für die Auerochsen im NSG.. |
Reichenbach hat, auch wenn das Dorf nur relativ wenige Anwesen umfasste, doch eine wechselvolle und
sicher auch interessante Geschichte hinter sich.
Der
Ortsnamen
Ein
kleines Rätsel ist der Ortsname, der in Bayern und in den angrenzenden Gebieten
öfter anzutreffen ist. Die vielleicht bekanntesten Namensvettern sind das 1118
gegründete ehemalige Benediktinerkloster
in Reichenbach am Regen (heute
eine Einrichtung der Barmherzigen Brüder), die Kreisstadt
Reichenbach im Vogtland, mit über 25000 Einwohnern der größte um 1200 an der
Unteren Göltzsch entstandene namensgleiche Ort, Reichenbach in der Oberlausitz
(bei Görlitz), schon seit etwa 1200 Stadt, die sogar von zwei Flussläufen
(Schwarzer Schöps und Görlitzer Neiße) berührt wird, sowie Reichenbach im
Schweizer Hochgebirge an der Kander: diese Reichenbach liegen an einem Fließgewässer,
an einem bestimmt auch fischreichen Bach. Einen Bachlauf aber sucht man in
unserem alten Reichenbach vergeblich, denn der Speckbach wurde ja erst 1977
wegen des Bergbaues von seinem ursprünglichen Bett weg in einem ca. 966 m
langen unterirdischen Stollen (Durchmesser etwa 2,80 m) durch das Dorf
umgeleitet. Seit einigen Jahren ist dieser künstliche Bachlauf nur mehr der
Überlauf des Speckbachs, der nahezu wieder auf seiner alten Trasse durch das
Naturschutzgebiet Leonie und die Stadt Auerbach fließt. Die Erklärung
"Reichenbach = kräftiger, lauter Bach" von Schnelbögl, dem
ehemaligen Direktor des Staatsarchivs Nürnberg, klingt auch nicht sehr logisch,
denn höchstens eine Quelle könnte an der Namensgebung beteiligt gewesen sein.
Reichenbach im Ortenaukreis führt seinen Namen auf den Gründer zurück: der
Mönche Richow aus dem
nahen Benediktinerkloster Gengenbach
soll die Ortschaft gestiftet haben; aus Richenbach wurde dann das heutige
Reichenbach. Vielleicht ist es bei "unserem Reichenbach" ähnlich!
Joseph
Köstler hat in Band XIX seiner handgeschriebenen Chronik die historische
Entwicklung des Dorfes auf mehreren Seiten dargestellt; seine Ausführungen
flossen u. a. in diesen Artikel mit ein. (1, Seite 423 ff)
Entstehung
im 12./13. Jahrhundert
Da Reichenbach weder 1119 in der Gründungsurkunde von
Kloster Michelfeld (Anm. s.u.), noch 1144 bei der Markt- und Pfarreierhebung Auerbachs
genannt ist, wurde es wahrscheinlich ähnlich wie Degelsdorf etwa zwischen 1150
und 1250 gegründet, und zwar ziemlich sicher von einem Mitglied der
Patrizierfamilie Stromer. Dieses bedeutende Geschlecht gründete im Mittelalter
in unserer Gegend Dörfer und besaß Bergwerke und Eisenhämmer, Mühlen,
landwirtschaftliche Güter und zahlreiche andere Anwesen. Auch im damaligen Nürnberg
spielten die Stromer eine große Rolle, und einzelne von ihnen, z.B. Johannes
Stromer (1432-1527), sollen nach Köstler gleichzeitig in Nürnberg
Ratsmitglieder und in Auerbach Bürgermeister gewesen sein.
Aus den Anfangsjahren von Reichenbach existiert noch eine alte Sage.
Anm.: Der ehemalige Direktor des Staatsarchivs Nürnberg
Fritz Schnelbögl vermutet, dass mit Sigehartisruit in besagter Urkunde entweder
Saaß oder eben Reichenbach gemeint sein könnte. (2, Seite 34)
 |
Urkundlich wird Reichenbach
erstmals 1300 erwähnt;
der neue Pfarrer Hermann von
Hartenstein
(1300-1335 in Auerbach) erklärt damals
dem Kloster Michelfeld gegenüber,
dass die Pfarrei Auerbach
nach seinem Tode keinen Anspruch
auf Pfarrechte und
den Zehnt
in Reichenbach und den Mühlen
und Hämmern habe, die am Speckbach
bereits bestünden oder erst noch
entstehen würden.
Dieses Foto (Okt. 2005) zeigt
das ehemalige Dorfzentrum,
wo links und
rechts die Bauernhöfe standen;
heute hat die Natur wieder voll
von den einst bebauten Flächen
Besitz ergriffen. |
Das
Abgabewesen
Das Dorf Reichenbach hatte schon bald nach seiner
Entstehungszeit fünf bzw. sechs Höfe und ein Haus für den Hirten. Sämtliche
Höfe waren zehntpflichtig an das Kloster Michelfeld und Gilthöfe; Nr. 1 und
6 gaben auch ihre Gilt zum Kloster, 3, 4 und 5 zum Bürgerspital und 2 und 5 zur
Frauenmesse bei der Pfarrkirche Auerbach.
Beim Zehnt wurde unterschieden zwischen dem Getreidezehnt oder großen Zehnt (1/10 von allem Getreide), dem
Grünzehnt oder kleinen Zehnt (1/10 von Gras,
Heu usw.) und Blutzehnt (jedes zehnte Haustier). Dabei wurde nur der Getreidezehnt
in natura vom Feld weg eingehoben oder wie man früher sagte
eingefext, Grün- und Blutzehnt konnten ersatzweise auch mit Geld bezahlt
werden.
Man muss dabei bedenken, dass die Bauern ihre Höfe bis 1803 bzw. 1848 nur in
Erbpacht hatten; das Erbrecht ging auf die Kinder über, konnte aber auch an
fremde Personen verkauft werden. Der Eigentümer, Giltherr (Gült) genannt, musste bei
jedem Besitzwechsel, z. B. dem Tod des Hörigen seine Zustimmung geben und bekam dafür das
Besthaupt,
d.h., das beste Stück Vieh aus dem Stall; später wurde daraus eine bestimmte
Geldsumme, die 5 bis 10 Prozent des Gutwertes ausmachte, und
Handlohn genannt wurde.
Die Gilt war also eine Art Pacht oder Mietzins.
.jpg) |
Die
Abgaben,
Gilt und Zehnt
wurden durch Karl den Großen
und seine Nachfolger
nach orientalischem Vorbild
in der ersten
Hälfte des 9. Jhdts.
eingeführt, und erst 1848
durch einen
Bodenzins abgelöst.
(Originalbild von Albrecht
Dürer,
190x89 cm, im Germanischen
Nationalmuseum Nürnberg)
|
Die Höfe
und ihre Besitzer
Die Namen der ältesten Reichenbacher Bauern sind
leider nicht bekannt bzw. zum Teil nicht unmittelbar einem bestimmten Hof zuzuordnen. In einer Türkensteuerliste
von 1542 sind aufgezählt Fritz Trenß der Ältere, Hans Trenß, Fritz Trenß
der Jüngere, Jörg Steger und des Ulrich Helds Witwe. Im Jahre 1597 hießen sie
Hans Trenß, Jörg Held, Heinz Mayer, Hans Pernecker (Sternecker?), Fritz Trenz
und Wastlbauer; Hirt war Mathes Schleicher. 1604 werden genannt Georg Trenß,
Georg Held, Hans Trenz, Hans Friedl und Hans Trenz der ältere. Unmittelbar nach
dem Dreißigjährigen Krieg (1618-48) hießen die Anwesensbesitzer Georg Trenß,
Paulus Trenß, Hans Stümpfl, Leonhard Kroher, Hans Ziegler und Peter Stümpfl.
Während des Dreißigjährigen Krieges (1618-48) wurde Reichenbach schwer
getroffen: 1634 rafften Pest und
Typhus einen Teil der Bewohner hinweg, und 1641
brannten die Schweden nahezu alles nieder. So blieben die meisten Felder einige
Jahrzehnte öd liegen, ehe die Menschen ihre Häuser, Ställe und Städel wieder
errichten konnten und neues Leben ins Dorf einkehrte.
Auf dieser alten Karte (BayernAtlas)
sind die Anwesen eingezeichnet.
Hof Nummer 1, beim Ströhl, war nur dem Kloster Michelfeld abgabepflichtig.
Er gehörte 1721 dem Kaudlmüller Johann Greger, 1762 dem Hans Trenz, der
bereits Ströhl genannt wurde. Seit diesem Jahr hießen seine Besitzer
ununterbrochen Trenz. Ebenfalls schon seit vielen Generationen war auf diesem
Haus die Dorfglocke, die Georg Trenz 1952 im Austausch mit Georg Kohl in die
Pinzigbergkapelle hängte; die Trenz versahen dort auch lange Jahre den
Mesnerdienst. 1977 wurde Stefan Trenz mit seiner Familie von der Maxhütte abgelöst
und errichtete in Nitzlbuch einen stattlichen Aussiedlerhof. Die letzte
Reichenbacher Glocke, die ursprünglich aus Zeltenreuth im heutigen Truppenübungsplatz
stammt und die Georg Kohl bei der Ablösung 1938 mitgenommen hatte, läutet seit
1989 in der Kapelle „zum Guten Hirten“ in der Auerbacher Siechensiedlung.
Anwesen Nummer 2, beim Kannes, gehörte 1374 zum Stiftungsgut der
Frauenmesse und musste dorthin 1560 u.a. jährlich 6 Viertel Korn (in Bayern
entsprach ein Viertel 18,5 Liter), 2 Viertel Hafer, 4 Käse und 30 Eier reichen.
Der Benefiziat der Frauenmesse hatte alle
Donnerstage in der Pfarrkirche ein Prozessionsamt mit dem Allerheiligsten zu
halten, eine Tradition, die bis auf den heutigen Tag gepflegt wird.

1721 saß auf diesem Hof
(Foto Oktober 2005)
Paulus Trenz, genannt der Schwarz, dessen Witwe 1725
Hansjörg Ziegler heiratete. Mit Hansmichl Trenz, genannt der Kannes, kam der
Name Trenz 1750 wieder zurück und blieb bis 1876 auf dem Anwesen, zu dem in
dieser Zeit ca. 67 Tagwerk Grund gehörten. Nach einer im Hof ausgebrochenen
Feuersbrunst, die einen Teil des Dorfes einäscherte, kauften die jüdischen Güterhändler
Isak Lamm und Jakob Sternberger das Anwesen von Vitus Trenz, der mit seiner
Familie nach Kirchenthumbach zog. Sie veräußerten mehrere Grundstücke daraus
und tauschten es schließlich mit Michael Wittmann und seiner Ehefrau Anna,
einer verwitweten Höllerer, aus Neuhaus. 1888 übernahm Georg Höllerer den Hof
und übergab ihn 1930 an Sohn Johann, welcher 1950-58 Landtagsabgeordneter war;
seit 1959 bewirtschaften Erich Höllerer (1931-2021) bzw. dessen Sohn Norbert mit ihren Familien diesen
Bauernhof in Reichenbach.
Hof Nummer 3, beim Mathes, gehörte schon vor 1425 zum Bürgerspital und musste
an dieses z.B. 1560 u.a. an Michaeli 7 Viertel Korn, an Martini 7 Viertel Hafer,
an Ostern ein Schock (60 Stück) Eier, an Pfingsten 4 Käse, eine Vasnachtshenne
abführen, sowie 4 Frontage mit dem Pflug leisten. Der frühere Hausnamen war
deshalb auch Spitlbauer.
Der Zehent oder Zehnt gehörte wie bei allen Reichenbacher Anwesen
dem Kloster Michelfeld.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg baute das Spital den
niedergebrannten Hof (Foto Oktober 2005)
wieder auf und veräußerte ihn mit ca. 75 Tagwerk Grund
um 150 fl an Hans Stümpfl, einen Bauernsohn aus Degelsdorf. 1721 saß auf dem
Anwesen Mathes Hofmann, von dem der Hausname herstammt. 1838 erwarb Georg
Michl Rupprecht aus Ohrenbach das damals stark verschuldete und schließlich
vergantete Anwesen, zu dem ca. 95 Tagwerk Grund gehörten. Die Hofstelle wurde
bis vor kurzem noch von Anna Rupprecht, einer Schwester des verstorbenen
Vorbesitzers, bewohnt. 2019/2020 wurde der Hof abgebrochen. Auf einem Teil des
Areals wurde ein neues Wohnhaus errichtet.
Das Anwesen Nummer 4, beim Kroher, heute Hausnummer 14, gehörte schon
seit 1384 zum Bürgerspital Auerbach. 1560 musste der Hof dorthin an Michaeli 7
Viertel Korn, an Martini 7 Viertel Hafer, an Vasnacht und St. Gallus jeweils
eine Henne, an Pfingsten und Weihnachten je 5 Käse, und an Ostern 2 Schock Eier
abliefern, sowie 4 Frontage mit dem Pflug einbringen. Der älteste bekannte
Besitzer ist 1560 Georg Held, der den Hausnamen "der Groß" trug, weil
das Anwesen mit über 100 Tagwerk das größte Reichenbachs war. Der im Dreißigjährigen
Krieg völlig zerstörte Hof wurde erst 1667 vom Spital wieder aufgebaut und
zwei Jahre später mit ca. 100 Tagwerk Grund an Leonhard Kroher, auf den der
Hausname zurückgeht, um 220 fl verkauft. Seit 1837, als Georg Trenz, ein Sohn
von Nr. 5, den Hof erwarb, sitzen Trenz auf diesem Anwesen. Fritz Trenz musste
ebenfalls der Maxhütte weichen, baute seinen großen Aussiedlerhof aber in
Reichenbach unweit der bisherigen Hofstelle. Auch die Kapelle, die seit etwa
1870 beim Anwesen stand, errichtete Trenz neu.
Heute ist die Landwirtschaft verpachtet.
1374 kam der Bauernhof Nummer 5, heute beim Leindl Hausnummer 15, der
bislang ein Bamberger Lehen war, und auch dem Spital abgabepflichtig war, zur
Frauenmesse der Auerbacher Pfarrkirche. Als Gilt musste 1560 sein Inhaber
jeweils dem Benfiziaten und dem Spital an Michaeli 3,5 Viertel Korn, an Martini
3,5 Viertel Hafer, jährlich 8 Käse und eine Vasnachtshenne abliefern, dazu
waren auch drei Frontage mit dem Pferd zu leisten. Der Frauenmesser mußte
jeweils an Martini 3 Achtl Korn verbacken und das Brot daraus an arme Leute
verteilen lassen. Diese Abgaben mussten, nachdem 1555 die Frauenmessstiftung
einging, bis 1848 an den Auerbacher Pfarrer entrichtet
werden.
Ab 1520 sind Georg Kraus, Heinz Maier, Georg Trenß, Hans Stümpfl, Georg Trenß
und Hansmichl Trenß Hofbesitzer. 1777 heiratete Friedrich Vogl die Witwe seines
Vorbesitzers und gab dem Anwesen seinen Hausnamen "beim Vogl", der
knapp zwei Jahrhunderte darauf blieb. Als 1937 Johann Friedl in Bernreuth abgelöst
wurde, erwarb er diesen Hof und brachte auch seinen Hausnamen „beim Leindl“
mit nach Reichenbach. 1977 erfolgte wegen des Erzabbaues erneut eine Ablösung;
diesmal bauten die Friedl ihr Anwesen als modernen Aussiedlerhof in Reichenbach
wieder auf.
Das kleinste Anwesen, Nummer 6 beim Heiner, war nur dem Kloster
Michelfeld abgabepflichtig. Seine Besitzer waren u. a. 1721 Georg Ziegler,
genannt Mühlgörgl und 1762 Johannes Trenß mit dem gleichen Hausnamen. 1770
bis 1875 gehörte der Hof zur Neumühle und wurde von dort aus als „Zubaugütl“
bewirtschaftet; das Haus bewohnten in diesen 100 Jahren Taglöhner. 1875
erwarb es Elias Weber, der es 12 Jahre später vertauschte und nach Gunzendorf
zog. 1887 wurde Heinrich Rupprecht aus Penzenreuth neuer Besitzer; dieser Name
blieb bis zur Ablösung durch die Maxhütte auf dem Anwesen.
Das Hirthaus
(Hirtenhaus), später Dornröschen
Wie in anderen Dörfern existierte auch in Reichenbach seit alters her ein
Hirte; für diesen hatte das Dorf ein eigenes Hirthaus gebaut, welches die
Nummer 7 trug und von Degelsdorf her kommend am Ortseingang links stand. Das
Holzhäuschen wurde erst im vorigen Jahrhundert durch ein Steingebäude ersetzt.
Der Dorfhirte hatte von der Gemeinde auch Äcker und Wiesen zur Eigennutzung überlassen
bekommen, und er musste deshalb auch den Zehnt ans Kloster Michelfeld abführen.
Bis nach dem 2. Weltkrieg hatte das Dorf
Reichenbach einen Hirten.
1952 erwarb Hugo Ebert (1909-1973), ein Heimatvertriebener aus Albernhof im Egerland, mit
seiner Ehefrau Margarete (1915-1982) das ehemalige Reichenbacher Hirthaus und einigen Grund von der
Gemeinde. Er baute das Anwesen um und an, und eröffnete 1954 darin die Gaststätte
Dornröschen, ein gemütliches Lokal, das sich regen Zuspruchs der
Ortsbewohner und vor allem zahlreicher Spaziergänger und Ausflügler erfreute.
Als besondere Attraktion stellte der rührige Wirt Hugo Ebert 1954 zur
Fußball-Weltmeisterschaft
(16. Juni bis 4. Juli 1954)
einen Fernseher für seine Gäste auf, was ihm den Namen Fernseh-Hugo
einbrachte.
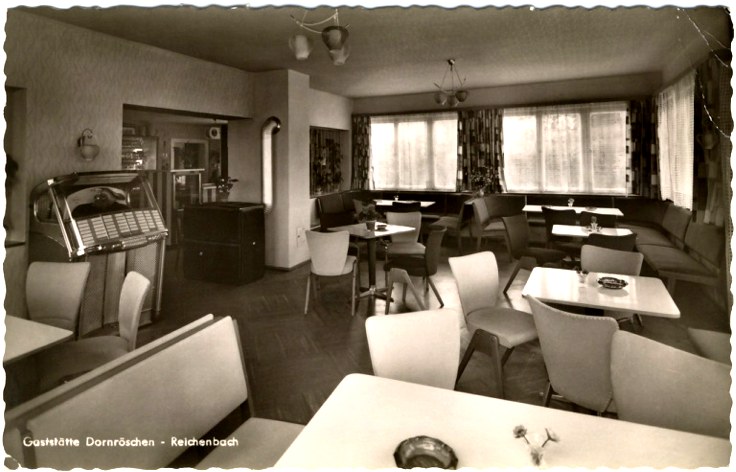
Diese alte Ansichtskarte zeigt einen Teil des Gastraumes des
Dornröschens.
Die Karte überließ mir freundlicherweise Jürgen Marx
aus Thierstein. Danke!
Durch zahlreiche Um- und Anbauten war aus dem ehemaligen Hirtenhaus
ein ansehnliches Lokal geworden, das auch gerne von jüngeren Leuten und
ganzen Familien aufgesucht wurde.
Nach dem Tode von Hugo Ebert 1973 führten Tochter Inge
(1942-2016) und ihr Ehemann Günther
Leißner (1939-2014) das Dornröschen bis zur Ablösung erfolgreich weiter. Durch
seine Schließung 1975 wurde unsere Heimat wieder um ein gemütliches Lokal ärmer.
Tochter und Sohn errichteten sich mit ihren Familien neue Häuser in Reichenbach
an der AS 43. (Foto s. weiter unten)
Das
heutige Dorf
Hausnummer 8 in Reichenbach trägt die Pinzigbergkapelle, die erstmals 1708 nach einem Gelübde von einem Krottenseer
Bauern errichtet wurde. Das heutige Kirchlein wurde 1818 der Muttergottes
geweiht und wird von einigen frommen Idealisten liebevoll gepflegt.
Die Anwesen 9 (Albersdörfer) und 9a (früher Huber, heute Trenz) entstanden
nach dem 2. Weltkrieg. Die beiden Häuser auf dem Eichelberg, Nummer 10 (Raß
Werner) und 11 (Trenz Johann) waren ebenfalls in dieser Zeit gebaut worden und mussten
um 1975 dem Bergbau weichen.

Nach der Ablösung des Dornröschens errichteten 1975 Horst Ebert und Günther
Leißner mit ihren Familien etwas abgesetzt vom alten Dorf in schöner Lage die
schmucken
Häuser Nummer 12 und 13.
Naturschutzgebiet
Grubenfelder Leonie

Einige Jahre nach dem Ende des
Eisenerzbergbaus 1987 wurde das ehemalige Bergbaugebiet im Jahre 1996 als Naturschutzgebiet
ausgewiesen. Auf den Fluren des alten Dorfes Reichenbach weiden heute Auerochsen
und Exmoor-Ponys friedlich nebeneinander und verhindern
ein Verbuschen des Areals. (Foto 2009)

andere
"Reichenbach":
Weitere Reichenbach werden gerne aufgenommen,
wenn mir die Webadressen mitgeteilt werden.

verwendete und weiterführende Quellen
| 1 |
Köstler, Joseph, Chronik der Stadt Auerbach, 27 handgeschriebene Bände,
Lagerort Archiv der Stadt Auerbach |
| 2 |
Schnelbögl,
Fritz, Auerbach in der
Oberpfalz, 1976 |
letzte Bearbeitung dieses Artikels am 4. März 2022

 |
Wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen möchten,
können Sie mich hier
erreichen
oder telefonisch unter 09643 683.
|
 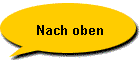
|