|
| | Nitzlbuch
1k.jpg)
|

|
Die
Ortschaft Nitzlbuch (am
1.6.2005 183 Einwohner)
liegt südöstlich von Auerbach, gut 2 km vom Rathaus
entfernt. (Ausschnitt einer Karte von 1938)
„Seit Jahrhunderten bestand Nitzlbuch aus 16 oder 17 Anwesen
oder Bauernhöfen. Die Höfe waren nicht groß, die neun größeren umfaßten
jeweils 45-50 Tagwerk, die acht kleineren 12-36 Tagwerk.
Auch die Qualität der Felder ist nicht die beste und dem flüchtigen
Sandboden kann man nur durch reichliche Düngung ergiebige Ernten
abringen. ... |
Die
Bewohner waren an Arbeit und Sparsamkeit gewöhnt und ihre Genügsamkeit an Kost
und Kleidung war sprichwörtlich.“
(1,
Band XIX, Seite 281)
Erste
Ansiedlung
In welchem Jahr die erste Besiedelung von Nitzlbuch erfolgte, lässt sich nicht
genau sagen. Man darf aber annehmen, dass bereits Jahrhunderte vor Christus
Menschen hier anzutreffen waren, wie verschiedene Gräberfunde aus dem Wellucker
Wald beweisen. Eine allgemeine und umfassendere Besiedelung in diesem Teil des
ehemaligen Nordgaues erfolgte etwa ab der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts n.
Chr..
Ortsname
Nitzlbuch
Über den Ortsnamen Nitzlbuch gibt es verschiedene Auslegungen. So schreibt
Joseph Köstler um 1915: „Der Ortsname ist urdeutsch u. besteht aus 2
altdeutschen Wörtern. Das Wort lüzel bedeutet so viel wie klein, das Wort buch
aber heißt so viel wie Buchenwald. Lüzelbuch kann man also übersetzen mit
'Buchenwäldchen' oder mit 'der kleine Buchenwald'. Dieser Namen erzählt uns
also ein Stück der Gründungsgeschichte, er sagt uns, daß die erste
Ansiedlung in einem Buchenwäldchen geschah oder am Rande desselben.“ (1,
Seite 253 f)
1kk.jpg)
Buchenwald im Frühling
Im „Abriss der Geschichte der Hauptdörfer der Gemeinde Nitzelbuch“ aus dem
Wappenakt der Staatlichen Archive Bayerns von 1955 ist dagegen folgendes zu
lesen: „Während das Grundwort -buch, das einen Buchenbestand oder Buchenwald
kennzeichnet, keiner weiteren Erklärung bedarf, ist das Bestimmungswort Nitzel-
oder Litzel- - nur diese letztere
Form findet sich in den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Quellen -
nicht mit absoluter Sicherheit zu deuten. Die Möglichkeit, in Litzel- das mhd.
Adjektiv lizel = klein, zu sehen, die angenommen wurde, verliert an Wahrscheinlichkeit,
wenn wir die überlieferten Formen betrachten, die nur als 'Lucenbuohe' (1119)
und 'Luizenbuch' (1140), und erst 1409 als 'Lützelpuh', 1564 als 'Lützlbuech'
vorkommen. Mit ziemlicher Sicherheit dürfen wir in Lucen-, Luizen- den
Personennamen Liuzo, Liuzi, Liuzin, Liuzila annehmen, der in den
hochmittelalterlichen Quellen, den Traditionen, häufig bezeugt ist. Die
Wandlung des Anfangs-L zu N, also von Litzelbuch zu Nitzelbuch, ist ein
ersatzdissimilatorischer Vorgang, der meist auftritt, wenn in einem Wort zweimal
ein l vorkommt. Unter Litzel- Nitzelbuch wäre also weiter nichts als die
Siedlung am Buchenwald des Liuzin zu verstehen.“ (3)
Schnelbögl schließt sich 1976 der Köstlerschen Deutung an und meint kurz und
bündig: „Auf frühere Vegetation läßt schließen Nitzlbuch (früher Lützelbuch
= kleiner Buchenbestand). 'Lützel' bedeutete im Mittelalter wenig, klein.“ (3,
Seite 26)
Ob sich in Nitzlbuch nun „ein kleiner Buchenwald“ oder „der Buchenwald des
Liuzin“ verbirgt, vermag von hier nicht eindeutig geklärt zu werden; fest
steht jedenfalls, dass die Buche dem Ort den Namen gab.
Kloster
Michelfeld
Die früheste bekannte Geschichte der Gegend um Auerbach und damit auch die
Nitzlbuchs ist sehr eng verbunden mit Bamberg. 976 setzte Kaiser Otto II.
(973-983) Herzog Heinrich von Bayern ab und löste den Nordgau, also etwa die
heutige Oberpfalz, aus seiner unmittelbaren Verbindung zum bayerischen
Herzogtum. Die politische Leitung erhielt der Babenberger Graf Berthold (auch
Berchthold) von Schweinfurt; die Ostmark, etwa Niederösterreich fiel zur
gleichen Zeit an seinen Bruder Luitpold. Stammsitz des ostfränkischen
Grafengeschlechts der Babenberger oder Popponen war die Burg Babenberg, die
etwa an der Stelle des heutigen Bamberger
Domes stand.
 |
Kaiser
Heinrich II. der
Heilige
(1002-1024), der im Jahre 1007
zusammen mit seiner Gattin,
der hl.
Kunigunde,
das Bistum Bamberg gründete,
schlug diesem auch Besitzungen
des
Nordgaues hinzu.
(Büste von Kaiser Heinrich
im Bamberger Dom)
|
Durch Abtretungen des Eichstätter Bischofs von dessen Gebiet
wurde 1016 Auerbach zusammen mit Velden, Hersbruck, Vilseck, Hopfenohe,
Thurndorf und anderen
Orten bambergisch.
Graf Friedrich von Hopfenohe, der am 3. April 1119 ohne männlichen Erben starb,
hatte vom Stifte Bamberg bedeutende Güter unserer Gegend als Lehen. Diese
drohten seinem Schwiegersohn
Pfalzgraf Otto von Wittelsbach, der im Kloster
Ensdorf begraben ist, zuzufallen.
Otto der
Heilige, 1102-1139 Bischof von Bamberg,
wollte dies unbedingt verhindern und gründete am 6. Mai 1119 das Kloster
Michelfeld.
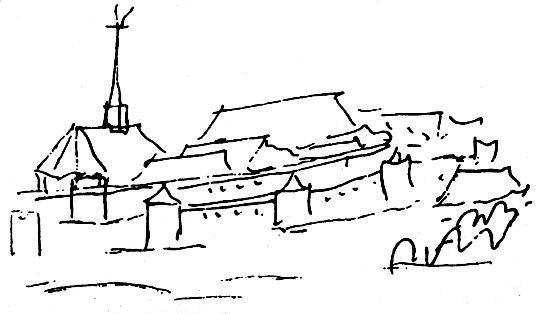
Der
fromme Stifter vermachte seinem neu gegründeten Kloster Michelfeld (älteste
Ansicht von 1522) fast alle Orte der Umgebung, darunter auch
Perhartsruit
(Bernreuth), Uveluch (Welluck) und Lucenbuohe (Nitzlbuch).
 |
Vogt, also weltlicher
Schutzherr
des Klosters, sollte nach dem Willen
seines Gründers Bischof Otto
der Graf Berengar
I. von Sulzbach sein.
Manchmal wird dieser auch Berengar II. genannt.
Es handelt sich um die selbe Person,
egal ob Berengar I. oder Berengar II.
(Detail einer Statue des Grafen
in der ehem. Klosterkirche
Kastl)
|
Pfarrei
Auerbach
Als 1144 der Bamberger Bischof Egilbert auf Bitten des Michelfelder Abtes
Adalbert
(1142-1155) den um das rasch aufblühende Benediktinerkloster entstandenen Markt
„in villam Vrbach“, also ins nahe gelegene Dorf Auerbach verlegte, richtete
er dort auch eine eigene Pfarrei ein.
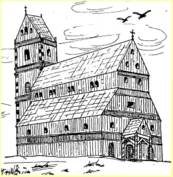 |
Die
ebenfalls 1144
auf dem Platz der heutigen
erbaute erste Kirche
war aus Holz
und dem hl. Apostel Jakobus
geweiht ("alter Patron").
|
In der Urkunde
zur Pfarreierhebung wird ausdrücklich auch „Luicenbuch“ als fortan zur
neuen Pfarrei Auerbach gehörend genannt.
1184 verzichtete das Kloster Michelfeld zugunsten des Bischofs von Bamberg auf
den Marktort Auerbach, behielt dabei jedoch das Patronat über die Kirche; in
der entsprechenden Urkunde wird Nitzlbuch „Lucenpueg“ geschrieben. Eine
Auswirkung dieser Maßnahme war, dass die Bewohner von Nitzlbuch den Zehnt, der
eigentlich dem Pfarrer von Auerbach gehören sollte, an das Kloster Michelfeld
entrichten mussten. Dessen Zinsbuch und Güterverzeichnis von 1409 bzw. 1436
nennen in Welluck und Litzelbuch jeweils 16 abgabepflichtige Anwesen. In
Notzeiten geschah es sogar, dass vom Kloster das ganze Dorf, bzw. eben die von
seinen Bewohnern zu leistenden Abgaben, an reiche Leute verpfändet wurden, so
z.B. Litzelbuch 1439 an „die Weißenbergerin“, eine Adelige aus Weißenberg
(Gemeinde Edelsfeld).
Gerichtsbarkeit
Im Mittelalter hatte die Ausübung der Rechtsprechung auch auf dem Lande eine
große Bedeutung. Die sogenannte niedere Gerichtsbarkeit über Nitzlbuch
übte das Kloster Michelfeld bis zu seiner ersten Auflösung 1556 aus. Vom
Niedergericht wurden Verträge beurkundet, kleinere Vergehen geahndet, sowie
Polizeigewalt, Steuerveranlagung, Jagdrecht usw. gegenüber den
Gerichtsuntertanen
ausgeübt.
Die hohe Gerichtsbarkeit und das
Halsgericht lagen zunächst in
den Händen der jeweiligen Lehenträger, ab 1373 dann beim neu geschaffenen Landgericht in Auerbach.
Der Hochgerichtsbarkeit, auch
Blutgericht genannt, waren Vergehen vorbehalten,
auf welche die Todesstrafe stand; ursprünglich waren dies Mord, Notzucht,
Diebstahl und Brandstiftung. Der Auerbacher Galgen stand bis 1690 auf dem
Rabenstein, einem Sandhügel außerhalb der Stadtmauern, auf dem Weg nach
Welluck gelegen; die Straßennamen Galgenberg und Am Rabensteig erinnern heute
noch daran.
In einem „Ehehaftsrecht“ von 1500 heißt es u. a., dass unter Vorsitz des
Kloster- wie auch des Auerbacher Landrichters dreimal im Jahr in Ebersberg zu
Gericht gesessen werden soll, und dass zu diesem Gerichtssprengel u. a. die Dörfer
Ebersberg, Kaundorf, Unter- und Oberfrankenohe, Nunkas (alle im heutigen Truppenübungsplatz), sowie Welluck und Nitzlbuch gehörten, die „mit ihren
zugehorungen zu dorffern, veldte und mit gehölze, mit grundt und poden Unsers
Closters aigen sind“.
Holz-
und Waldrechte
Die Anwesen in Nitzlbuch waren in alter Zeit wegen ihrer bedeutenden Holz- und
Waldrechte sehr gesucht und wurden deshalb im Vergleich zu anderen auch teuer
gehandelt und verkauft. Auch der Hoferbe - in unserer Gegend meistens der jüngste
Sohn - musste bei der Übernahme zahlen, wie dieses Beispiel zeigt: 1595 kaufte
Peter Kugler von Nitzlbuch den Hof seines verstorbenen Vaters Erhard Kugler (Kuglerhatl)
mit Vieh und allem Inventar um 180 Gulden.
Als Gegenleistung für die uralten Rechte mussten die Bauern z.B. bei den Jagden
der Grundherrschaft als Treiber mitwirken, sowie ganzjährig Jagdhunde pflegen
und füttern. Als die Rechtler später von Haltung und Fütterung der
herrschaftlichen
Jagdhunde befreit wurden, mussten sie stattdessen Hundshaber und später
Hundsgeld an das Kastenamt in Auerbach entrichten.
 |
Dieses Gebäude,
heißt im Volksmund
"alte Münze",
weil König Wenzel hier
Ende des 14. Jhdts.
die "Auerbacher Pfennige"
prägen ließ.
Es handelt sich aber
um das Kastenamt,
in dem der Kastner
Amtslokal und Wohnung hatte.
Der Kastner war ein
kurfürstlicher Beamter,
der für seinen Herrn
die Steuern und Abgaben
einnehmen musste. |
Darüber hinaus mussten die
Grundholde, wie die Bauern im Gegensatz zum Grundherrn hießen, Getreide, Hühner,
Eier und Käse abliefern und Frondienst leisten. 1572
hatten die Nitzlbucher
z.B. für ihre Forstrechte ans kurfürstliche Kastenamt nach Auerbach u.a. 27
Viertel Forsthaber (1 bayrisches Viertel waren 18,5 Liter), 12 Forstkäse, 13
Forsthähne, 12 Forsthühner, 1 Schock (60 Stück) Forsteier und 14 Viertel
Hundshaber abliefern.
Wegen des Forstrechts mussten die Nitzlbucher öfters umfangreiche Prozesse führen,
so 1607, 1663 und 1680. Sie wollten ihre Privilegien erweitern oder zumindest
behalten, während die kurfürstlichen Forstmeister diese gerne beschneiden oder
am besten gleich abschaffen wollten. Nachdem in den Wirren des 30-jährigen
Krieges (1618-48) der Forstrechtsbrief von Nitzlbuch verloren gegangen war,
wurden die alten Rechte erst nach langwierigen Verhandlungen 1663 bzw. 1664
durch den Auerbacher Landrichter Hans Heinrich von Lemmingen „gegen Verraichung
der Jährlichen Achtundzwainzig Viertl Halzhabern ohne weithern Waldtzünß,
wie von alters gebreuchig ist gewest,“ wieder bestätigt.
Wie Köstler berichtet, waren noch 1812 sämtliche 17 Anwesen Nitzlbuchs forstberechtigt,
unter ihnen 9 mit einem ganzen, 6 mit einem halben und 2 mit einem viertel
Recht. Zwischen 1863 und 1875 wurden viele dieser Rechte vom Staat um
durchschnittlich 4000 Mark abgelöst. Um 1915 hatten nur mehr die Anwesen Nummer
1, 5, 11, 12, 13 und 14 ein Forstrecht, und zwar je 12 bayerische Klafter Holz
(1 bayerischer Klafter waren 3,13 m³), 4 Fuder Aststreu und 45 Kubikmeter
Bodenstreu. Die letzten dieser Forstrechte wurden dann im Zuge der Erweiterung
des Truppenübungsplatzes 1936-39 abgelöst, da der Großteil des „Oberen
Wellucker Waldes“ in diesen eingegliedert wurde.
Nitzlbucher
Bauern und Anwesen
Die Namen der ersten Nitzlbucher sind nicht bekannt; überhaupt kamen erst um
1400 bleibende und erbliche Familiennamen auf. Die erste namentlich bekannte
Aufzählung ist eine Türkensteuerliste aus dem Jahre 1542. Diese
Türkensteuer
wurde unter Kaiser Karl V. (1519-1556) eingehoben, um u.a. die Kosten zur Abwehr
der Türken, die 1529 erstmals vor Wien standen, aufzubringen. In Nitzlbuch
waren u.a. steuerpflichtig Georg Beck, Hans Lösch, Georg Neubauer, Fritz Wernel,
Hans Kramer sen., Georg Gundl, Endres Straner, Endres Schober, Hans Bair, Peter
Beck, Mathes Straner, Endres Widmann, Erhard Grafs Witwe, Georg Gundls Witwe und
Friedl Lösch.
Die meisten alten Nitzlbucher Hausnamen stammen wahrscheinlich aus dem 16. und
17. Jahrhundert: Hans Kaiser, der um 1540 Anwesen 14 besaß, war der Koiser, ein
Mahtes Kugler der Kuglmathes (Nummer 11), ein Ulrich Bayer der Boyeröl (12), ein
Michl Friedl der Michlbauer (13);
von Hermann stammt Hirma, von Konrad Kounz, von Eberhard Äberl, von Rupprecht Rüppl,
von Sebastian Wastl usw..
1721 lebten in Nitzlbuch (Quelle: Standbuch 348,
Staatsarchiv Amberg) folgende Bauern: Hans Eckerts
Witwe (Boyeröl), Hans Wallner (Rüppl), Hans Kuglers Witwe (Kuglmathes), Hans
Bernhard (Hirma), Mathes Wittmann (Wastlbauer), Hans Friedl (Kuglerhardl), Hans
Wiesent (Haller), Georg Kugler (Koiser), Hans Kugler (Hänslbauer), Hans Kraus
(Kraus), Hans Kugler der Mittlere (Barth), Hans Krembs (Kroher), Hans Haffners
Witwe (Spitzer), Hans Bayer (Rauherhans), Andreas Sporer (Michlbauer), Hans
Bauer (Eberl).
Die Bauernhöfe waren bis etwa 1800 nur erbliche Lehen, und erst seit dieser
Zeit, eigentlich erst seit 1848, wirkliches Eigentum des jeweiligen Bauern.
Gerade in der Zeit um 1848 galt Nitzlbuch als besonders wohlhabender Ort, so
dass das Sprichwort entstand: „Wenn eine Braut vom Himmel fällt, so fällt
sie auf Nitzlbuch!“
Wirtshaus in Nitzlbuch
1896 erwarb der Bauer Johann Georg Friedl das
Anwesen Nr. 13, beim Michlbauer, in Nitzlbuch. Zusammen mit seiner Frau
Maria geb. Lindner aus Hub, eröffnete er einen Kramladen.
(Hausnamen beim Kremer) Ihr Sohn Johann Friedl (1901-1967) betrieb
zusammen mit seiner Ehefrau Theresia (1898-1973), geb. Strell aus dem
nahen Ebersberg, ab 1929 eine Bierwirtschaft.
Deren Tochter Theresia wiederum heiratete 1969 Michael Pickel
(1932-2020)
aus Königstein. Zusammen brachten sie das Wirtshaus auf den neuesten Stand, und
betreiben es bis heute erfolgreich, auch nach dem Tod von Michael 2020.
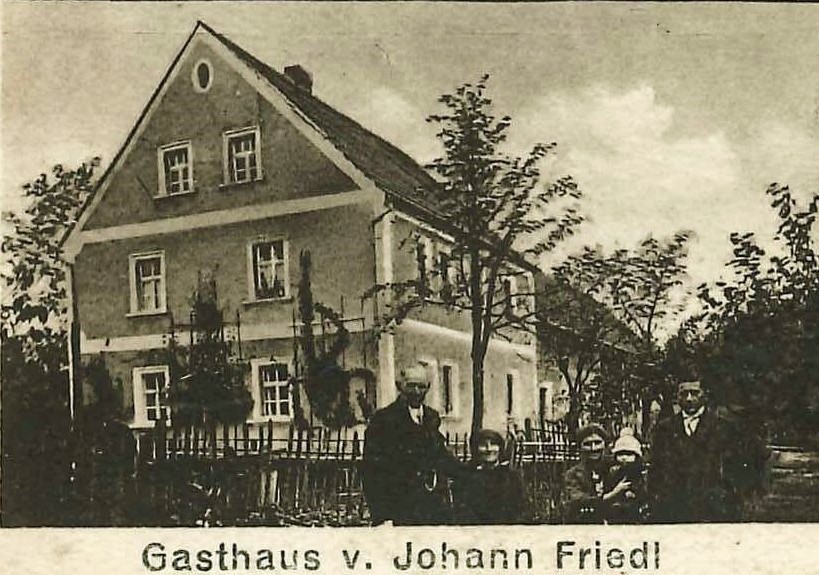
(Foto um 1948, Archiv Thomas Pickel)

Genauere
Angaben über die einzelnen Anwesen Nitzlbuchs und die gesamte Geschichte dieses
Ortes findet man sehr gut und ausführlich zusammengestellt in „Nitzlbuch/Bernreuth,
Geschichte einer bäuerlichen Region der nördlichen Oberpfalz“.
(4, Seite 107ff)

Nitzlbuch
und sein Eisenerz
Das in der ganzen Auerbacher Gegend in verschiedenen Tiefen anzutreffende
Eisenerz war bestimmt schon sehr früh ein Anziehungspunkt für die Menschen.
Der Überlieferung nach soll früher in Nitzlbuch auch ein Eisenhammer gestanden
sein, und zwar etwa beim heutigen Anwesen Nummer 14 (Koiser). Darauf deuten auch
die vielen Schlacken, die heute noch in dieser Gegend gefunden werden. Der
bereits verstorbene „alte Koiser“ berichtete von ganzen Fuhren davon, die
u.a. zum Straßenbau verkauft und verwendet wurden.
Zum Betreiben eines Eisenhammers war nicht nur Eisenerz, das sicher hier
gefunden
wurde, notwendig, sondern auch Wasser. Hierzu muss man erwähnen, dass etwa an
der Stelle des heutigen Anwesens Nummer 46 (Busunternehmen Cermak) früher ein
kleiner Weiher war, der durch verschiedene Quellen gespeist soviel Wasser
enthielt, dass es in einer Rinne zu Tal floss, wohl auch zum wesentlich tiefer
liegenden Hammer. Im Laufe der Zeit versiegten die Quellen, der Weiher trocknete
aus. Der Besitzer von Anwesen 3 Brütting füllte das Gelände schließlich
auf und veräußerte es an den heutigen Eigentümer.
Vorerst zumindest abgeschlossen wurde die Eisenerzförderung in Nitzlbuch durch
die Stilllegung der Grube Maffei am 29. Juli 1978.
|
 |
Während die Schächte selber mit
Kalksteinschotter verfüllt wurden,
erinnern die ehemaligen Fördertürme und Teile
der Schachtanlage
als Bergbaumuseum an den untergegangenen Eisenerzbergbau.
Unmittelbar neben den Maffeitürmen (rechts vorne) steht das
Heim
des ehemaligen Schützenvereins "Unter Uns" Nitzlbuch.
Nach dessen Auflösung ist es privat und wird als
Eventlocation
das Maffei betrieben.
|
Aus der seit
1906 voll betriebenen
Doppelschachtanlage Maffei wurden in den gut sieben Jahrzehnten des Betriebs aus einer maximalen Tiefe von 141 Metern
insgesamt
ca. 16 Millionen Tonnen Eisenerz gefördert und zur Verhüttung nach
Sulzbach-Rosenberg gebracht.
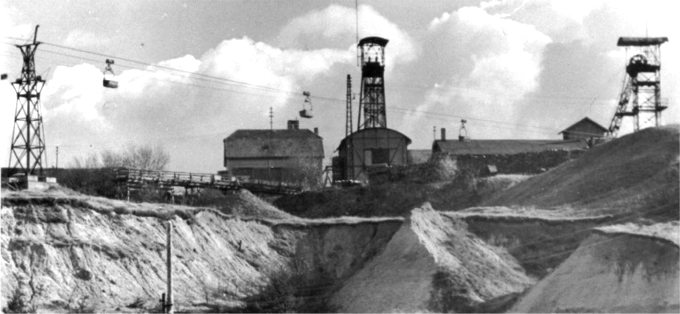
Schacht
„Maffei 1“ (links) war der Förderschacht und hatte einen rechteckigen
Querschnitt (2 mal 3 m); aus einer Tiefe von 137 m wurde in ihm das Eisenerz zu
Tage gebracht. „Maffei 2“ (rechts) mit gleicher Tiefe war rund gemauert,
hatte einen Durchmesser von 7 m und diente dem Personen- und Materialtransport.
Im Vordergrund wurde der Sand abgebaut, mit dem im Spülverfahren in den ersten
Jahren, in denen von unten nach oben abgebaut wurde, die ausgeerzten Stollen
wieder verfüllt wurden. Im etwa ab 1925 angewendeten „Teilsohlenbruchbau“
war das Verfüllen nicht mehr notwendig, weil hierbei in Scheiben von oben nach
unten abgebaut wurde. (Foto um 1925)
Rund um die als "Industriedenkmal" stehen gebliebenen Fördertürme von Maffei erinnern
verschiedene Einrichtungen des gleichnamigen Bergbaumuseums an diese
wirtschaftlich günstige Zeit Nitzlbuchs, Hammer und Eisen im Wappen der
ehemaligen Gemeinde zeugen ebenfalls von der engen Verbindung der Ortschaft
mit dem wertvollen Bodenschatz Eisenerz.
Das
Gemeindewappen
Auf Antrag des damaligen Gemeinderates wurde Nitzlbuch durch das Staatsministerium
des Innern am 10. März 1956 die Führung eines eigenen Wappens zuerkannt.
Dieses sollte nach dem Willen des Gemeinderates Bezug auf die Ortsgeschichte
nehmen und zugleich auch den wirtschaftlichen Verhältnissen der Bewohner
Ausdruck geben.
 |
Der
halbierte („geminderte“) Adler
erinnert an die enge Verflechtung
Nitzlbuchs
mit dem Kloster Michelfeld,
das ja schon mit der Gründungsurkunde
1119 dem
Evangelisten Johannes
geweiht worden war,
dessen Symbol bekanntlich ein Adler
ist. |
Die grundherrschaftliche Zugehörigkeit des Dorfes mit dem Kloster wurde
praktisch erst mit dessen Aufhebung bei der Säkularisation 1803 beendet. Als
Vorbild für das Nitzlbucher Wappen diente das guterhaltene Siegel des Abtes
Werner Lochner (1461-1494). Die blaue Grundfarbe des Gemeindewappens weist auf
die Zugehörigkeit zum Herzogtum Bayern seit 1268 und natürlich zum heutigen
Freistaat Bayern hin. (1268 wurde der letzte Staufer Konradin, erst 16 Jahre
alt, nach einem Scheinprozess in Neapel enthauptet. Die ihm gehörenden Ländereien
im Norden Bayerns gingen daraufhin in den Besitz der Wittelsbacher über, die
1180 bis 1918 in Bayern regierten.)
„Die Struktur der heutigen Gemeinde und ihrer Einwohnerschaft bestimmen
Erzvorkommen
und Landwirtschaft. Durch Hammer und Schlegel als heraldische Symbole für den
Bergbau und die damit zusammenhängende Industrie wird auf die wirtschaftlichen
Verhältnisse und die Zusammenhänge mit der Maxhütte hingewiesen. Für die
Landwirtschaft wurde als Symbol eine einfache Ähre aufgenommen.“ (5)
Das gut gelungene und beziehungsreiche Wappen von Nitzlbuch hat im Sitzungssaal
des Auerbacher Rathauses einen Ehrenplatz und wird sicher auch in vielen Häusern
der ehemaligen Gemeinde zu finden sein.
Die
politische Gemeinde Nitzlbuch und ihre Vorstände bzw. Bürgermeister
Im
Alltagsleben der Landbevölkerung spielten nicht nur herrschaftliche Bindungen,
z.B. an das Kloster Michelfeld oder an das Spital Auerbach, eine Rolle, sondern
auch die „Gemeinde“ als Verband der Dorfbewohner nahm einen wichtigen Platz
ein. Diese „Gmain“ oder wie wir sagen „Gmoi“ hatte als oberstes Gremium
die Versammlung aller zu Ortschaft gehörenden Haushaltsvorstände und war für
das Leben des einzelnen nicht weniger bedeutsam als sein Platz in der feudalen
Ordnung. Die wichtigsten Repräsentanten der „Gmoi“ waren früher üblicherweise
die „Dorfvierer“, also vier von der o.a. Versammlung gewählte Männer. Auch
die Stadt Auerbach hatte bis 1813 jeweils gleichzeitig vier Bürgermeister, die
sich im dreimonatlichen Turnus bei der obersten Leitung der Stadt abwechselten.
Zwar fungierte die „Gmoi“ zum Teil als verlängerter Arm der Obrigkeit, etwa
indem sie die Einbringung von Steuern und Abgaben organisierte oder für die
Stellung von Schararbeitern (Arbeitskräfte für das Leisten der Frondienste)
sorgte. Doch die Gemeinde regelte auch das soziale und wirtschaftliche
Zusammenleben der Ortsbewohner. Sie regulierte Interessen und Konflikte
verschiedener innerdörflicher Gruppen, und sie wurde bisweilen auch nach außen
politisch aktiv, formulierte Beschwerden und Petitionen oder organisierte den
Widerstand gegen Übergriffe der Herrschaft.
Nicht allein weil man auf die Hilfsbereitschaft oder soziale Anerkennung der
Nachbarn angewiesen war, sondern weil schon auf der Ebene des täglichen
Wirtschaftens kein Gemeindemitglied wirklich völlig unabhängig war, konnte man
sich den Regeln des Dorfes nicht entziehen. Wer Vieh hatte, trieb es am Morgen
dem Gemeindehirten zu; wer sein Getreide ernten und vor allem dreschen wollte,
musste sich nach den gemeinsam festgesetzten Terminen richten. Jedes
Gemeindemitglied zog - wenngleich in unterschiedlichem Maße - seinen Nutzen aus
der „Gmoi“. Dafür hatte es sich anteilig auch an den gemeindlichen „Bürden“
zu beteiligen: an Steuern und Abgaben, am Wegebau, dem Unterhalt der Hirten und
der anderen Gemeindebediensteten, an der dörflichen Armenversorgung usw.
Ein Meilenstein
in der Geschichte der Gemeinden war die Entstehung des neuen bayerischen
Staatsgebiets zwischen 1799 und 1818. Im Zuge der Reformpolitik von König Max
(IV.) I. Joseph und seines Ministers Maximilian Graf von Montgelas kam es in
dieser Zeit zu einer grundlegenden Neubildung der Gemeinden: Aus über 40.000
Ortschaften wurden in Bayern zu Beginn des 19. Jahrhunderts ca. 7.300 Gemeinden.
Zum Vergleich: Seit der Gemeindegebietsreform von 1978 bestehen in Bayern nur
noch rund 2.000 politisch selbständige Gemeinden.
Das
erste Gemeindeedikt von 1808
Zur Organisation des staatlichen Finanz- und Steuerwesens in Bayern wurden im
Jahre 1808 als Grundlage der Steuererhebung einheitliche Kataster geschaffen und
die Ämter in Steuerdistrikte eingeteilt. Das erste Gemeindeedikt vom 28. Juli
bzw. 24. September 1808 hatte die Formierung der politischen Gemeinden zum Ziel.
Eine der Bestimmungen dazu war, dass die Gemeindegrenzen genau mit den
Steuerdistriktgrenzen übereinstimmen sollten.
Das
zweite Gemeindeedikt von 1818
Die endgültige Selbstverwaltung der Gemeinden brachte das zweite Gemeindeedikt
vom 17. Mai 1818. Die Verwaltung der Gemeinden erfolgte darin durch einen
Gemeindeausschuss, der sich aus Gemeindevorsteher und aus dem Gemeindepfleger,
wenn notwendig zusätzlich aus einem Stiftungspfleger und aus drei bis fünf
weiteren Gemeindebevollmächtigten zusammensetzte. Dies waren die Vorgänger der
heutigen Gemeinderäte.
Mit den Gemeindeedikten wurden Städte und größere Märkte zu
Munizipalgemeinden zusammengefasst und nach der Einwohnerzahl in drei Klassen
eingeteilt: Städte 1. Ordnung (wie z.B. München, Nürnberg oder Regensburg),
Städte 2. Ordnung (wie z.B. Amberg, Weiden) und Städte 3. Ordnung (wie z.B.
Auerbach, Pegnitz) oder Märkte (wie z.B. Neuhaus, Königstein).
Daneben gab es Ruralgemeinden (Landgemeinden) mit einem Gemeindevorsteher an der
Spitze. Eine solche Ruralgemeinde bildete z.B. Nitzlbuch (mit Welluck usw.),
dessen Gemeindevorsteher folgende Männer waren: (siehe
auch 4, Seite 11 f; wenn nur eine
Jahreszahl angegeben ist, bedeutet dies nicht, dass die betreffende Person nur
in diesem Jahr amtierte, sondern dass in alten Unterlagen nur aus diesem Jahr
Hinweise auf den Amtsinhaber gefunden wurden.)
|
1818
|
Johann
Balthasar Steubl, Bauer in Welluck 10 (dieses Anwesen existiert heute
nicht mehr); er war der Überlieferung nach der angesehenste Mann im Dorf
und einer der wenigen, die lesen und schreiben konnten.
Steubl war vorher schon Dorfhauptmann“ gewesen.
|
|
1828
|
Anton
Barth, Bauer in Nitzlbuch 33 (alt 16; 1869 erwarb die Gemeinde das Anwesen
als Hirthaus; nach der Eingemeindung 1978 wurde es Wohnhaus für sozial
schwächere Personen).
|
|
1833
|
Balthasar
Krembs, Bauer in Welluck 1 (alt 2, beim Frank´n oder beim Fritz´n)
|
|
1839
|
Peter
Leißner, Bauer in Nitzlbuch 33 (alt 16; siehe bei Anton Barth); Leißner
stammte aus Pferrach.
|
|
1843-1848
|
Johann
Georg Deinzer, Bauer in Welluck 5 (alt 21); ihm gehörte bis 1875 dieses
Anwesen mit dem Hausnamen beim Gartner.
|
|
1848-1852
|
Johann
Wallner (Welluck 15, alt 14, beim Streber; das Anwesen ist 1865 z.T. in
Hausnummer 15 aufgegangen) oder Johann Sebastian Wallner (Nitzlbuch 27,
alt 17, beim Rüppl oder Hirmer); welcher von beiden in diesen Jahren
Gemeindevorsteher war, konnte wegen der Namensgleichheit H.-J. Kugler
nicht genau ermitteln.
|
|
1853-1861
|
Johann
Georg Deinzer, Bauer in Welluck 5 (alt 21; s.o.;) er tauschte 1875 dieses
sein Anwesen gegen den Hof (heute) Welluck 1 ein.
|
Neue
Gemeindeordnung von 1869
Durch die neue
Bayer. Gemeindeordnung für die rechtsrheinischen Gebiete vom 29.04.1869 wurde
die Einteilung in Munizipalgemeinden mit den angeführten drei Klassen sowie in
Ruralgemeinden zugunsten einer Unterscheidung in Gemeinden mit städtischer
Verfassung (mittelbare und unmittelbare Städte und Märkte) sowie in Gemeinden
mit Landgemeindeverfassung aufgegeben.
Die Gemeindevorsteher der vormaligen Ruralgemeinden wurden nun auch „Bürgermeister“
genannt; in Nitzlbuch waren dies bis kurz nach dem Ende des 2. Weltkriegs
|
1861-1903
|
Johann
Kugler, Bauer in Welluck 31 (alt 7, beim Kuglerhartl oder beim Gässlweber);
er war zunächst Gemeindevorsteher, ab 1869 lange Jahre Bürgermeister und
seit 1862 auch einige Zeit Landrat
|
|
1903-1911
|
Hans
Krieger, Schwiegersohn des Vorgängers im gleichen Anwesen
|
|
1922-1933
|
Leopold
Schmidt, Bauer in Nitzlbuch 1, beim Kroher
|
|
1933-1945
|
Johann
Zimmermann, Welluck 34 (alt 16, beim Gechersbauern; 1954-74 Gasthaus „d´
Wonger Marie“)
|
|
1945-1948
|
ein
amerikanischer Offizier der Militärregierung
|
Die Gemeinde
Nitzlbuch wurde im Rahmen der von der amerikanischen Militärregierung nach
Kriegsende 1945 befohlenen Zusammenlegung von Gemeinden mit Wirkung vom 1.1.1946
(zusammen mit der Gemeinde Ebersberg, zu der Bernreuth gehörte) in die Stadt
Auerbach eingegliedert. Die Nitzlbucher konnten und wollten sich mit dieser
Zwangsmaßnahme nicht abfinden und machten mehrere Eingaben zur Wiedererlangung
der bereits jahrhundertealten Selbständigkeit; Johann Haslbeck und Franz
Schmidt fuhren sogar nach München ins Innenministerium.
Auf
Beschluss des bayerischen Landtags und mit Anordnung des Innenministeriums vom
23.12.1947 wurde die Selbständigkeit der Gemeinde Nitzlbuch mit Wirkung vom 1.
April 1948 wieder hergestellt; Ebersberg mit Bernreuth blieb bei Auerbach. Der
daraufhin von der Stadt Auerbach u. a. am 12.10.1948 gestellte Antrag auf
Wiedereingliederung von Nitzlbuch wurde am 28. Oktober 1949 vom Innenministerium
abgelehnt und dazu auch die Umgliederung von Bernreuth nach Nitzlbuch zum
1.11.1949 angeordnet. Zugleich wurde eine „raschestmögliche Durchführung
von Neuwahlen des Bürgermeisters und des Gemeinderats in der vergrößerten
Gemeinde Nitzlbuch“ gefordert. (aus
6)
Der Gemeinderat von Nitzlbuch hatte sich mit Beschluss vom 29.7.1949 zunächst
gegen die Eingliederung von Bernreuth gestimmt, u.a. weil „durch eine solche
Maßnahme die Bauerngemeinschaft von Nitzlbuch (635 Einwohner) praktisch ihre
Selbständigkeit an die Flüchtlingsmehrheit von Bernreuth (etwa 1.100
Einwohner) verlieren und das Eigenleben der Bürger Nitzlbuchs eine schwere Störung
erleiden würde.“ (aus 6, Gründe für die Entschließung,
Seite 6)
Mit Beschluss vom 4.10.1949 stimmte der Nitzlbucher Gemeinderat schließlich der
Eingemeindung von Bernreuth zu, die dann zum 1. November des gleichen Jahres
vollzogen wurde. Am 15.7.1950 kamen auch Dornbach und Ebersberg sowie am
1.1.1952 noch Beilenstein und Pinzig nach Nitzlbuch, das nun einige Jahre
folgende Ortschaften umfasst: Nitzlbuch selber, Beilenstein, Bernreuth (Ort und
Lager), Dornbach, Ebersberg, Pinzig, Sackdilling, Sand und Welluck. 1957 waren
Bernreuth (alte Ortschaft und Lager), sowie Beilenstein, Dornbach, Ebersberg und
Pinzig wegen des Truppenübungsplatzes vollständig von den Bewohnern geräumt
und wurden deshalb aus der politischen Gemeinde Nitzlbuch ausgegliedert.
1k.jpg)
Dieses
Foto um 1950 zeigt einen Teil des Dorfes Nitzlbuch und links Bernreuth.
Oben ist noch die Anlage des ehemaligen Westlagers
Bernreuth zu erkennen.
Bürgermeister
der Gemeinde Nitzlbuch in und nach diesen turbulenten Jahren bis zur
Gemeindegebietsreform vom 1. Mai 1978 waren
|
1948-1953

|
Johann
Haslbeck, Bauer und (ab 1949 auch) Gastwirt in Welluck 9 (alt 18); er
wurde zunächst vom 1.4.1948 bis zur 1. Wahl am 2.5. des gleichen Jahres
kommissarisch eingesetzt und dann gewählt; bei der wegen der
Eingemeindung von Bernreuth durchgeführten Neuwahl am 27.8.1950 erhielt
er trotz mehrerer Gegenkandidaten einen großen Vertrauensbeweis und blieb
Bürgermeister.
Am 22.3.1953 kam Bürgermeister Haslbeck (zusammen mit Maurermeister
Erhard Bühl) bei einem tragischen Verkehrsunfall unweit seines Anwesens
auf der B 85 ums Leben.
|
|
1953-1956
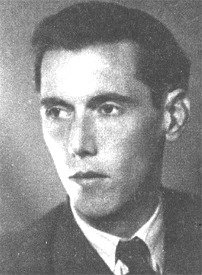
|
Alfred
Burggraf, heimatvertriebener Kaufmann im Lager
Bernreuth, Baracke 11,
wurde bei der notwendigen Neuwahl am 17.5.1953 neuer Bürgermeister
|
|
1956-1972

|
Franz
Rippl, Heimatvertriebener aus dem Egerland (+ 1.4.2002); er war
Verwaltungsangestellter der Gemeinde und zugleich 16 Jahre lang deren 1. Bürgermeister.
In seine Amtszeit fällt u.a. 1963 der Bau des Gemeindehauses (heute
Welluck 8). Nach der Gemeindegebietsreform war Rippl 1978 bis 1990
Stadtrat in Auerbach.
|
|
1972-1978

|
Franz
Schnödt (+ 29.12.1982), Bauer in Welluck 13 (alt 42, beim Hartl Franz);
er war seit 1956 Mitglied des Gemeinderates und ab 1966 auch 2. Bürgermeister
von Nitzlbuch. Bei der Eingemeindung in die heutige Stadt Auerbach i.d.OPf.
zum 1. Mai 1978 übergab Schnödt als letzter Bürgermeister die Gemeinde
Nitzlbuch in wohlgeordneten Verhältnissen.
|
1ak.jpg)
Abschiedsfoto von Bürgermeister, Gemeinderat
und -verwaltung der damaligen Gemeinde Nitzlbuch. Der langjährige Bgm. Franz
Rippl wurde nachträglich links oben eingefügt.
Beim Inkrafttreten der
Gemeindegebietsreform zum 1. Mai 1978 zählte die bis
dahin selbständige politische Gemeinde Nitzlbuch immerhin etwas über 1.000
Einwohner, davon u. a. Welluck 608, Nitzlbuch 218, Sand 114 und Bernreuth 77. (Amtliches
Ortsverzeichnis für Bayern, Heft 380, Gebietsstand 1. Mai 1978)
verwendete und weiterführende Quellen
| 1 |
Köstler,
Joseph, Chronik der Stadt Auerbach, 27-bändiges handgeschriebenes Werkes, Lagerort Rathaus
Auerbach |
| 2 |
Wappenakt der Staatlichen Archive Bayerns |
| 3 |
Schnelbögl,
Fritz, Auerbach in der Oberpfalz, Auerbach 1976 |
| 4 |
Kugler,
Hans-Jürgen, Nitzlbuch/Bernreuth, Geschichte einer bäuerlichen Region
der nördlichen Oberpfalz, Auerbach 2000 |
| 5 |
Schreiben
des bayerischen Hauptstaatsarchivs an die Gemeindeverwaltung Nitzlbuch vom 20. Dezember
1955 |
| 6 |
Schreiben des Bayer. Staatsministeriums des
Innern vom 28. Oktober 1949 an die Regierung der Oberpfalz |
|
|

 |
Silcher, Friedrich (1789-1860)
Der traurige Bua
(Volksweise aus Kärnten) |
letzte
Bearbeitung dieses Artikels am 10. Februar 2025

|
Für Ergänzungen, Korrekturen usw.
bin ich sehr dankbar.
Hier oder unter 09643 683
können Sie mich erreichen!
|

|
 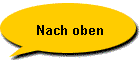
|