|
| |
Das
„Westlager“
oder „Lager Bernreuth“
Die
Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland am
16. März 1935
brachte die Notwendigkeit mit sich, für die Soldaten zum einen genügend Übungsraum
und zum anderen dort entsprechend viele Unterkünfte zu schaffen.

Das
Reichskriegministerium ordnete deshalb mit Erlass vom 28.2.1936 die umgehende
Erweiterung des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr nach Westen hin an.
Die
Planung
Ein weiterer Erlass, diesmal durch das
OKH
(Oberkommando Heer), vom 15.5.1936 bestimmte: „Im erweiterten Truppenübungsplatz
Grafenwöhr sind insgesamt 3 Lager vorgesehen.
| a) |
das Hauptlager oder auch Ostlager genannt, mit einer
Unterbringungskapazität für eine Infanteriedivision, |
| b) |
das Westlager, mit einer Unterbringungskapazität für eine
Panzerdivision und mit einem zusätzlichen Stallraum für die Pferde von 2/3
einer Infanteriedivision; das ist eine Unterbringungskapazität von 626
Offizieren, 11.524 Mann und 2.195 Pferden.
a.
Lage: im Raum Dornbach - Zogenreuth – Auerbach - Bernreuth
b.
Raumbedarf: Für diese Unterbringungskapazität ist ein Raumbedarf von
150 ha erforderlich.
c.
Bahnanschluss: Geplant ist die Errichtung eines besonderen Lagerbahnhofs
im Anschluss an die Strecke Hersbruck - Auerbach unter gleichzeitigem Ausbau der
Strecke ab Bahnhof Ranna für eine Tagesleistung von 24 Militärzügen.
|
| c) |
Das Südlager mit einer Unterbringungskapazität eines verstärkten
Infanterieregiments ... im Raum Altneuhaus ...“
(1 Ordner I, Seite 171) |
In
dem durch das OKH für das Westlager vorgesehenen Raum wurden umgehend
Untersuchungen nach einem geeigneten Gelände durchgeführt. Ergebnis war, dass
nur südlich von Bernreuth eine sehr günstige Lage ist.
Ablösung
des Dorfes Bernreuth
Durch die Festlegung des Standorts für das Westlager
im Juni 1936 wurde eine erneute Korrektur der Westgrenze des Truppenübungsplatzes
und damit die Ablösung der Ortschaft Bernreuth notwendig, wogegen die RUGes
* (Reichsumsiedlungsgesellschaft) keine Einwände hatte.

* Die Reichsumsiedlungsgesellschaft (RUGes)
war 1935 als Vollzugsorgan der Reichsstelle für Landbeschaffung für die
Neuansiedlung oder Entschädigung von für Zwecke der Wehrmacht enteigneten
Grundbesitz eingerichtet worden. Grundlage dafür bildete das Gesetz über die
Landbeschaffung für Zwecke der Wehrmacht vom 29. März 1935. Neben der
Zentralstelle in Berlin bestanden im gesamten Reichsgebiet verteilt rund 50
Zweig- und Nebenstellen für den Landankauf; eine davon war in Eschenbach. Darüber
hinaus gab es 10 Güteroberverwaltungen, 87 Gutsverwaltungen und 20 örtliche
Hoch- und Kulturbauleitungen.

Die ersten Ablösungsverträge zwischen dem Deutschen Reich, vertreten durch die
RUGes, und den bisherigen
Grundstücks- und Anwesenbesitzern wurden im Oktober 1936 geschlossen, die
letzten im Mai 1938.
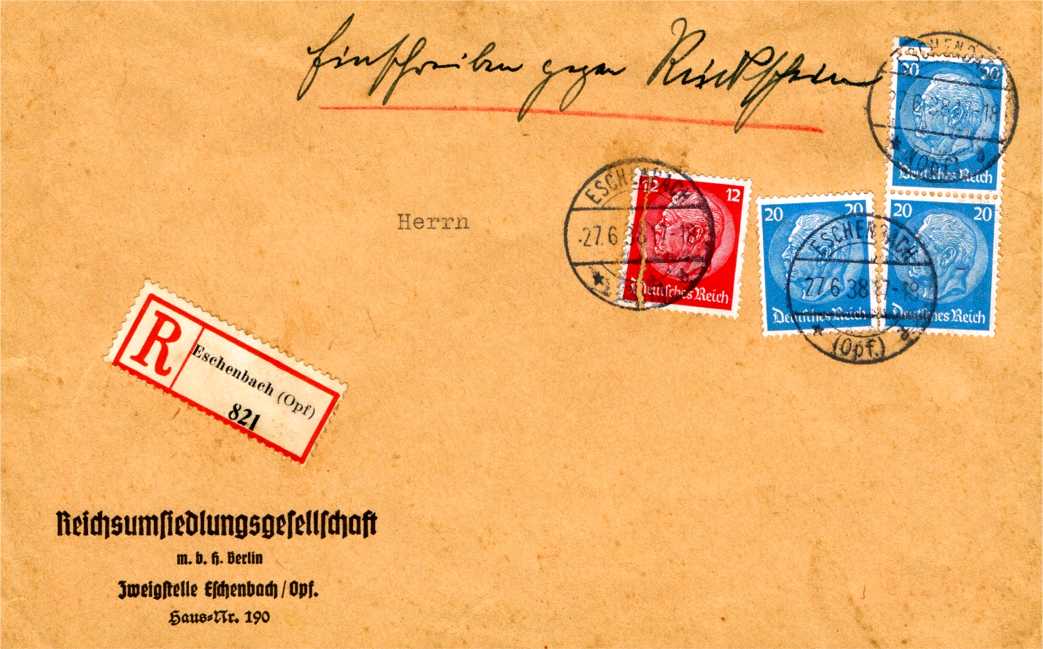
Die
Anwesensbesitzer von Bernreuth bekamen bald "Post" von der RUGes, die
nichts Gutes bedeutete.

Die meisten der abgelösten und größtenteils von ihren ehemaligen Bewohnern
verlassenen Häuser des Dorfes Bernreuth (aus 2, Seite 93) wurden etwas hergerichtet, mit
Tarnfarbe angestrichen und in den nächsten Jahren wie folgt belegt bzw. genutzt:
|
HausNr
|
Nutzung
|
|
1
|
Wohnung
des Bauingenieurs Kraft
|
|
4
|
Standort-Verwaltung
und Wache
|
|
8
|
Wohnung
für die Bauingenieure Jasper und Klein
|
|
13
|
Wohnungen
für Offiziere
|
|
14
|
Wohnungen
für Offiziere
|
|
15
|
Werkstatt
für den Telefonbau
|
|
17/18
|
Wohnungen
für die Bauingenieure Krüger und Spörl
|
|
19
|
Wohnung
für den Leiter der Nebenstelle Bernreuth der Truppenübungsplatz-Kommandantur
Major der Reserve Wurm; (seine Nachfolger waren Major Tschammer von Osten
und Hauptmann Dr. Ludwig Merkl aus Schlicht)
|
|
20
|
Schmiedewerkstatt
|
|
22
|
Dienststelle
der Heeresneubauleitung
und Telefonvermittlung
|
|
23
|
Postamt
und Kommandantur
|
|
24
|
Wohnung
für den Dienststellenleiter Brömer
|
|
27
|
Polizeistation
|
|
28
|
Wohnung
für den Telefonisten und späteren Polizisten Wellnhammer
|
|
29
|
Wohnung
für Max Lorenz, Telefonbauer
|
|
31
|
Kanzlei
der Gemeinde Ebersberg
|
|
32
|
Wohnung
für den Telefonisten Dietl
|
|
34/35
|
Wohnungen
für Polizisten
|
Die
anderen Häuser wurden z. T. noch von den früheren Eigentümern, welche im Lager
Arbeit gefunden hatten, bewohnt, oder sie wurden gleich abgerissen.
Baubeginn
Zur Unterbringung der Bauarbeiter für das Westlager
begann man Anfang 1937 nördlich von Bernreuth mit der Errichtung eines Arbeiterlagers für 1.400 Personen. Innerhalb weniger Monate standen zwölf
Baracken mit einer Größe von je 40 mal 12 Meter sowie drei Wirtschaftsbaracken
mit Küchen und Speisesälen. Der Verwalter des Lagers hieß Ludwig St. und
stammte aus Auerbach. Die zahlreichen Arbeiter waren u. a. vorgesehen für den
Bau des eigentlichen Westlagers, von Schussbahnen, Zieleinrichtungen und
Bunkern. So wurde auch ein Bunker der französischen Maginot-Linie
nachgebaut, an dem die deutschen Soldaten dessen Erstürmung üben konnten.

Die Maginot-Linie war
ein
Befestigungsgürtel im Nordosten Frankreichs, angelegt in den dreißiger Jahren
des 20. Jahrhunderts unter dem französischen Kriegsminister André Maginot.

Das neu zu errichtende Westlager sollte am 1. Mai 1938 zu einem Drittel belegbar
sein, schrieb das OKH im Juli 1937 fest. Doch schon wenige Monate später, am
21.10.1937, musste der Bau des Westlagers infolge Baustoffmangels - insbesondere
fehlte das Eisen - zurückgestellt werden. Das bereits fertige Arbeiterlager
wurde der Kommandantur des Truppenübungsplatzes zur Unterbringung von Truppen
zur Verfügung gestellt.
Ein Jahr später, am 20.12.1938, verfügte die zuständige Wehrkreisverwaltung
XIII, die Unterkünfte nahezu ausnahmslos in Holzbauweise zu errichten und die
Straßen des geplanten Westlagers wie vorgesehen zu bauen. Zudem sollte die
Kapazität des Arbeiterlagers um 1.000 Plätze auf 2.400 aufgestockt werden.
Doch der Plan „Holzbauweise“ scheiterte an der Bereitstellung der großen
Holzmenge, und deshalb wurde auch der Bau der Straßen und Wege wieder zurückgestellt.
Der
2. Weltkrieg
|
Am
1. September 1939 verkündete Hitler
vor dem deutschen Reichstag in
Berlin,
dass die deutsche Wehrmacht
um 5.45 Uhr in Polen einmarschiert
sei,
dass seither „zurückgeschossen” werde.
Mit diesem Überfall auf
Polen
– dem keine Kriegserklärung
vorausgegangen war –
begann der 2. Weltkrieg. |
 |
Bei Kriegsbeginn war vom geplanten
großen Westlager Bernreuth nur das Arbeiterlager mit 2.400 Quartieren
vorhanden. Das Bauamt Grafenwöhr erhielt deshalb von den zuständigen Stellen
den Auftrag, auf dem vorgesehenen Gelände unverzüglich Arbeitsdienstbaracken für
ein verstärktes Infanterieregiment zu erstellen. So wurde statt der ursprünglich
vorgesehenen Steinbauten bis zum Ende des Krieges ein Barackenlager mit einer Fläche
von rund 1 mal 1,5 km errichtet, das bis zu 12.000 Soldaten und 2.000 Pferde
aufnehmen konnte. Zu den wenigen gemauerten Gebäuden gehörten
Waffenmeistereien, Schmieden und ein Lazarett für Pferde.
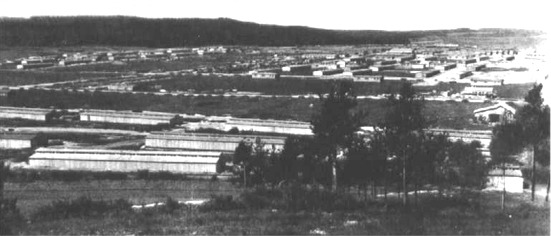
Das
„abgespeckte“ Westlager bestand hauptsächlich aus einzelnen Blocks, die
sich aus je drei Wohnbaracken für die Soldaten, einem Stabsgebäude und einer
Wirtschaftsbaracke mit Küche und Kantine zusammensetzen. Die einzelnen Kantinen
wurden von Zivilisten bewirtschaftet, u. a. den Familien Gebhardt, Leißner,
Schriefer, Niebler und Kugler.

(aus 4, Seite 612)
|
1
|
Arbeiterlager
|
7
|
Waffenmeisterei
|
|
2
|
Eingang Westlager
|
8
|
Hufschmiede
|
|
3
|
Theater
|
9
|
Pferdeställe
|
|
4
|
Kino
|
10
|
Pferdelazarett
|
|
5
|
Offiziersheim
|
11
|
Schleppdächer
|
|
6
|
Pferdetränken
|
|
|
k.jpg)
Kantine 1 im Westlager Bernreuth (Foto aus 5)
Im Frühjahr 1940 kamen die ersten
Truppen für die Unterbringung im Westlager mit Wehrmachtszügen am Bahnhof
Auerbach an und marschieren in langen Kolonnen Richtung Bernreuth. Es soll sich
dabei u. a. um Teile des Regiments „Großdeutschland“, eine Eliteeinheit,
welche vom Polenfeldzug zum Ausruhen heimkehrte und Tausende von Beutepferden
mit sich führte, gehandelt haben. Da die Pferdeställe im Westlager noch nicht fertig waren,
wurden die Pferde einstweilen im Wald östlich von Bernreuth angebunden.
 |
Der 1. Kommandant des Westlagers
Major Wurm (Mitte)
und der
letzte Hauptmann Dr. Merkl
aus Schlicht (links). |
Im
Frühjahr 1942 wurde eine Schallmess-Batterie nach Bernreuth verlegt, welche bis
Kriegsende blieb. Ihre Aufgabe war die Ausbildung von Unteroffizieren zum
„Orten eines feindlichen Geschützes zwecks Bekämpfung“.
Später kamen u. a. die SS-Division Wiking
und die spanische „Blaue Division“,
die für den Russlandfeldzug ausgebildet wurde, nach Bernreuth.

Mehrmals fand im Westlager ein
"Wehrmachtstag" wie hier 1943 statt. Am diesem "Tag der offenen
Tür" hatte die Bevölkerung die Möglichkeit, die gesamte Anlage zu
besichtigen. (Foto aus 5)
Von April bis Juli 1942 sowie im Sommer 1943 waren im Lager SS-Truppen und
Fallschirmjäger untergebracht, außerdem Holländer, Dänen, Norweger, Finnen,
Flamen, Italiener, Ungarn, Türken und Mongolen. 1944 lag sogar die russische
Befreiungsarmee des General
Wlassow, oder zumindest Teile dieser, in
Bernreuth. Einige der Russen, besonders Verwundete, welche nicht mehr
fronttauglich waren, blieben nach dem Krieg in Auerbach.
„Mit
den Soldaten kommt auch der Ärger. Auf den Wiesen werden Exerzierübungen
durchgeführt, bebaute Äcker als „Panzerstraßen“ benutzt, ganze
Gartenzaunreihen flachgelegt: Anfang 1941 wird der Zaun des J. B. Schindler
(Nitzlbuch 12) auf eine Länge von 45 m mit 9 Zementsäulen umgeworfen und
Michael Eisend (Nitzlbuch 14) muß gar 70 m Zaun mit 14 Zementpfosten
reparieren, 11 dieser Pfosten waren mit Gewalt abgesprengt worden. Auf einem
privaten Waldgrundstück werden 4 MG-Nester angelegt und für deren Tarnung 28 Föhren
abgebrochen.
Auch in ihrer Freizeit sind manche Soldaten rabiat. Oft streifen sie nachts
betrunken durch die Dörfer, zerschlagen Flaschen, werfen Fässer in die Teiche,
mißhandeln die angeketteten Hunde mit Stangen und Steinen, ... . Die
Dorfbewohner werden oftmals morgens gegen 2 Uhr durch dröhnende Schläge an die
Haustüren aus dem Schlaf gerissen, die Soldaten verlangen Eier. Da man ihnen
auch wegen der verschärften und kontrollierten Eierabgabe keine gibt, werfen
sie Steine durch die Fenster (z.B. bei Adelhardt, Geyer, Eisend und Friedl). Bei
einem dieser Würfe treffen sie den alten Friedl am Gesicht, dem Adelhardt droht
man mit dem Anzünden des Hofes, und einmal wird ein Bauer gar mit der Pistole
bedroht. ... Das Verhalten der im Westlager liegenden SS-Einheiten ist ebenfalls
wenig diszipliniert. Wenn sie Ausgang haben, und sie haben Ausgang bis zum
Wecken, schwärmen sie in die umliegenden Orte und Gaststätten aus und fühlen
sich in ihrer Uniform wie Halbgötter. So beschwert sich z.B. der Auerbacher Bürgermeister
Huber am 7.8.1943 in einem Brief an die Kommandantur des Truppenübungsplatzes:
...“ (4, Seite 617 f)
Die
Nähe des Westlagers und die Präsenz der Truppen hatte natürlich auch eine
positive Seite für Auerbach: „Die Anwesenheit von vielen tausend Soldaten
brachte Arbeitsplätze in die Gemeinde, waren es nun Bauarbeiter, Schreiner, Köche,
Putzfrauen, Kompanieschreiber, Schneider usw.. Da die Soldaten sehr gut mit
Lebensmitteln versorgt waren, profitierte auch die Bevölkerung davon. Das Militärlager
war z.T. eine offene Stadt, in der man spazieren gehen konnte. In der Nähe des
Eingangs, beim Haus Bernreuth 30, wurde ein Kino errichtet, in das jedermann
kostenlos Zutritt hatte, was besonders von den Kindern ausgiebig genutzt
wurde.“ (4, Seite 621)
Im
Lager Bernreuth wurden von Januar 1945 bis zum Kriegsende u.a. ungarische Verbände
neu zusammengestellt und ausgerüstet. Unter ihnen war als Militärgeistlicher
im Range eines Hauptmanns Gabor Vargha. Nach dem Krieg betreute dieser vom
Kloster Michelfeld aus die katholischen Ungarn der Diözesen Bamberg, Würzburg,
Regensburg und Eichstätt. Monsignore Vargha starb hochbetagt im Jahr 2002 und
fand auf dem Klosterfriedhof Michelfeld seine letzte Ruhestätte.
Die
Amerikaner marschieren ein
Am 19. April 1945 besetzten Truppen der 11. US-Panzerdivision des XII. Korps der
3. US-Armee Lager und Stadt Grafenwöhr. Sie waren über Forchheim, Pegnitz und Auerbach an
die Westgrenze des Truppenübungsplatzes vorgestoßen und hatten zunächst das
Westlager bei Bernreuth eingenommen, wo zu diesem Zeitpunkt schon kein deutscher
Soldat mehr war.
 |
Am 20. April 1945 übergab der
Kommandant des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr General Rupprecht in
seinem Gefechtsstand in der Nähe des Gefangenenfriedhofs den gesamten
Platz und damit auch das Westlager Bernreuth an die Amerikaner. |
Diese
ersten Kampftruppen der US-Armee blieben nur kurze Zeit in Bernreuth und zogen
bald weiter.
An ihre Stelle kam kurz darauf ein amerikanisches Versorgungs- und
Nachschubbataillon, das aus etwa 800 – 1.000 farbigen Soldaten bestand und
mehrere Monate blieb; die US-Army trennte ihre Truppen damals noch streng nach
der Hautfarbe. Sie zogen ins ehemalige Arbeiterlager ein, da das Militärlager
bereits als Gefangenenlager vorgesehen und reserviert war.
Diese amerikanische Nachschubeinheit hatte gleichsam als „Nachhut“ Hunderte
von deutschen Frauen und Mädchen dabei, die sich ihnen angeschlossen hatten.
„Dies waren z.T. echte Freundinnen, aber auch sogenannte leichte Mädchen,
welche sich in der kargen Nachkriegszeit aus der Bekanntschaft mit einem
US-Soldaten Geld und Verpflegung versprachen, den Soldaten überall hin folgten
und im derben Volksmund den Spitznamen „Amischicksen“ trugen. In Nitzlbuch
und Bernreuth waren zeitweise sämtliche Scheunen und Schupfen voll von ihnen.
Die Führung der US-Armee befürchtete eine Ansteckung von
Geschlechtskrankheiten und „fing“ die Mädchen regelmäßig ein, um sie auf
ihre Gesundheit zu untersuchen. Frauen ohne Ausweis oder Paß wurden allerdings
in den Gefängnissen von Eschenbach und Auerbach eingesperrt, bis man ihre
Identität ermittelt hatte. Einigen Soldaten dauerte die Zeit der Enthaltsamkeit
zu lange, sie täuschten in Eschenbach einen Feueralarm vor und befreiten die
gefangenen Mädchen mittels eines Feuerwehrwagens.“
(4, Seite 623)
In das früher nicht umzäunte Militärlager kamen jetzt deutsche
Kriegsgefangene: Frauen, SS-Angehörige und normale Soldaten. Bis zu 30.000
Gefangene sollen sich zeitweise gleichzeitig hier aufgehalten haben. Als erstes
mussten sie unterstrenger Bewachung das gesamte Areal mit einem Stacheldrahtzaun
umgeben. Etwa alle 50 Meter wurde ein Wachturm errichtet, und nachts war das
ganze Lager gleißend hell beleuchtet.
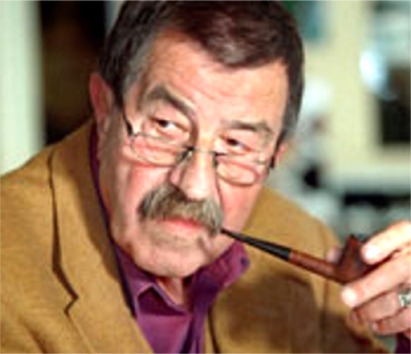 |
Der
sicher (später) bekannteste
Lagerinsasse war
Günter
Grass, der als knapp Achtzehnjähriger
nach einer Verwundung in der
Lausitz
über Marienbad und Kloster Tepl nach Grafenwöhr kam. |
Grass
(1927-2015)
erhielt 1999 den Nobelpreis
für Literatur und erinnerte anlässlich einer Lesung in Auerbach Ende 2003 an
seinen Zwangsaufenthalt in Bernreuth. (6, Seite 30)
Das
amerikanische Kriegsgefangenenlager im ehemaligen Westlager Bernreuth war nicht
lange in Betrieb, denn schon im Laufe der nächsten Monate wurden die meisten Gefangenen
aus der Gefangenschaft entlassen oder verlegt. Das Lager
leerte sich allmählich wieder. Als 1946 die letzten Kriegsgefangenen –
SS-Offiziere – nach Regensburg kamen, stand es schließlich leer.
Im März
1947 schickte die Lagerleitung des US-Internierungslagers Regensburg einen Trupp
von 60 Gefangenen und 17 Wachsoldaten nach Bernreuth. Sie sollten Aufgaben im
Straßenbau wahrnehmen und die Baracken abbrechen. Schon im Mai des gleichen
Jahres waren 100 Baracken zerlegt und mit US-Trucks oder mit dem
Zug vom Bahnhof Auerbach aus wegtransportiert worden.
Abbruch
des Lagers
Da in den ersten Nachkriegsjahren praktisch alle Baustoffe sehr knapp oder überhaupt
nicht erhältlich waren, blühte ein regelrechter Handel mit dem Abbruchmaterial
des Lagers. Auch nach Auerbach kam sehr viel, u. a. wurden Backsteine der
Barackenfundamente für den Neubau der Schule am Schwemmweiher erworben und
verwendet.
 |
Das neue Schulhaus
in Auerbach konnte
1951 bezogen werden.
Zum Bau waren auch
alte Backsteine
aus den Fundamenten
der Baracken
des ehemaligen
Westlagers Bernreuth
verwendet worden.
|
kk.jpg)
Dieses Foto (um 1955) zeigt rechts Teile von Nitzlbuch,
links schließen sich die Häuser von Bernreuth neu
an. Oben sind noch deutlich die Wege und Fundamente des ehemaligen Westlagers zu
sehen. (Foto aus 5)
Heute
erinnert vor Ort in der Natur praktisch nichts mehr an das „Westlager
Bernreuth“, das es in seiner ursprünglich geplanten Form nie gegeben hat.
verwendete Quellen
| 1 |
Truppenübungsplatz Grafenwöhr,
Chronik der ehemaligen Standortverwaltung Grafenwöhr, mehrere Ordner, unveröffentlicht |
| 2 |
Griesbach, Eckehart, Truppenübungsplatz Grafenwöhr, Behringersdorf 1985 |
| 3 |
Archiv Willi Zinnbauer, Sorghof |
| 4 |
Kugler, Hans-Jürgen,
Nitzlbuch/Bernreuth,
Auerbach 2000 (Bezugsquelle) |
| 5 |
Archiv
Hans-Jürgen Kugler, Auerbach |
| 6 |
Müller,
Markus, Trockenes Hausschwein und knurrender
Magen, in Sulzbach-Rosenberger-Zeitung vom 16./17. Juli 2005 |
|
Burckhardt, Paul, Die Truppenübungsplätze Grafenwöhr, Hohenfels, Wildflecken,
Weiden 1989 |
|
Mädl, Helmut, Die Geschichte des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr, 1980 |
|
Müller, Gerhard, 1. Oberpfälzer Kultur- und Militärmuseum
Grafenwöhr, Grafenwöhr
1990 |
|
|

|
Für Ergänzungen, Korrekturen usw.
bin ich sehr dankbar.
Hier können Sie mich erreichen!
|

|
letzte Bearbeitung dieses Artikels am 25. August 2018
 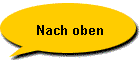 |