|
| |
Glückauf!
(traditioneller
Bergmannsgruß)

Bergbau und Hammerwesen
in Auerbach
Mit gutem Recht darf Auerbach, an der
Bayerischen Eisenstraße
und am Erzweg gelegen, auch heute
noch den Beinamen Bergstadt tragen, obwohl der Bergbau bereits seit einigen
Jahren (1987) zu Ende ist: über Jahrhunderte wurde in dieser
Gegend Eisenerz abgebaut, in Hammerwerken verarbeitet und mit den Produkten
Handel getrieben. Auerbach gehörte, wie die ganze Oberpfalz, zum Ruhrgebiet
des Mittelalters.
 |
Der Churchit
((Y,Er,La)[PO4]·2H2O,
früher Weinschenkit
genannt),
ein nur an wenigen Stellen
der Erde anzutreffendes Mineral,
wurde auch in
der Grube Leonie
in Auerbach gefunden.
Sammler kamen deshalb
von weit her,
um das seltene Gestein
zu sehen oder
gar zu erwerben.
|
(Foto aus der
Mineraliensammlung von W. Bäumler aus Weidenberg; siehe auch Mineralienkabinett)
Die
Schachtanlage Leonie (IV)
Auch das letzte noch fördernde Eisenerzbergwerk der Bundesrepublik, die der
Maxhütte gehörende Grube Leonie, war in Auerbach beheimatet. Schon von weitem
waren die moderne Schachthalle und der Förderturm mit dem Mischbett zu sehen.

Das Abteufen des Schachtes begann am 13.
August 1970, die Förderung von Eisenerz am 10. Oktober 1977. 1982 z.B. waren es 580.000 Tonnen,
was bei einer Belegschaft von etwa 350 Personen einer Förderung von fast 12
Tonnen pro Mann und Schicht entsprach.
Der Erzabbau wurde am 11. Mai 1987 eingestellt. (siehe unten)

Schachtanlage Leonie 1985 aus der Vogelperspektive (aus 1)
In beinahe 200
Meter Tiefe oder wie der
Bergmann sagt Teufe brachte ein Förderkorb Tag und Nacht die Kumpel, wie
die Bergleute heißen, in ca. 50 Sekunden nach unten zum Füllort (185 m bzw. +255
m NN), und das kostbare Eisenerz
nach oben, wo es zuerst zur Mischbettanlage kam. Der Schacht war insgesamt 194 m
tief.

In
der Mischbettanlage wurde das in unterschiedlichen Qualitäten geförderte Eisenerz,
wie der Name sagt, gemischt. Dann wurde es mit Lastkraftwagen zur Verhüttung nach
Sulzbach-Rosenberg transportiert.
 |
Damit die LKWs den Schmutz
an den Rädern
nicht auf die
öffentlichen Straßen
trugen,
mussten sie vor Verlassen
des
Werksgeländes
durch diese Waschanlage fahren. |
Die Grube Leonie war das letzte Kind des Auerbacher Erzbergbaues, denn als die
Maxhütte am Gründonnerstag (16. April) 1987 Konkurs anmeldete, bedeutete dies
das (zumindest vorläufige?) Ende des Eisenerzabbaus und die Schließung des
Schachtes am 11. Mai desselben Jahres. Eine
jahrhundertealte Tradition in Auerbach und seiner Umgebung ging damit zu Ende.
Dabei konnte die Grube Leonie in den knapp 10 Jahren Förderung (Oktober 1977
bis Mai 1987) eine stolze Bilanz aufweisen:
 |
den
108 Millionen DM Kosten für die Erschließung
standen 204 Millionen DM
Ertrag
für die Gewinnung von
rund 5,2 Millionen Tonnen Eisenerz
gegenüber
- mindestens weitere ca. 14 Millionen Tonnen
des Bodenschatzes
standen noch zur Verfügung. |
Von den zuletzt 286 Beschäftigten wurden viele von einem speziell eingerichteten
Sozialplan übernommen. 63 Männer wurden bei den Stilllegungsarbeiten einige Zeit
noch weiterbeschäftigt. Jüngere Bergleute allerdings mussten sich anderswo einen
geeigneten Arbeitsplatz suchen.
Unter Tage wurden die großen Maschinen zerlegt und nach oben gebracht, ebenso
die Betriebsmittel wie z.B. Öl. Dann wurden die Stollen abgemauert, und zuletzt der
senkrechte Schacht
mit Kalksteinschotter verfüllt. Auch über Tage wurde zurückgebaut und
aufgeräumt.
Diese Stilllegungsarbeiten dauerten insgesamt gut 2 Jahre. Am 28.11.1989
schaltete schließlich der damalige Maschinensteiger Günter Majewski
(+2017) die Pumpen ab.
Auf dem früheren Werksgelände der Maxhütte bieten heute verschiedene Betriebe Arbeitsplätze an.
Aus dem
ehemaligen über 60 ha großen Grubenfeld, das durch den Untertage-Erzabbau
zumindest teilweise zu
einem Bruchfeld mit tiefen, wassergefüllten Einbruchtrichtern wurde, ist im Mai 1996 das weiträumige Naturschutzgebiet
"Grubenfelder Leonie" geworden. Durch Hinzunahme weiterer Flächen
umfasst dieses NSG immerhin ca. 87 ha .

Als
besondere Attraktion setzte der Landesbund für Vogelschutz als Eigentümer des
gesamten Geländes im
Jahre 2001 eine Herde Heckrinder ein. Diese sind eine Rückzüchtung des
im 17. Jahrhundert ausgestorbenen Auerochsen oder Ur, nach dem die Stadt
Auerbach ihren Namen hat.
Im gleichen Jahr (2001) wurde der Tierbestand durch mehrere sehr seltene Przewalski-Pferde ergänzt, die
sich dort offensichtlich ebenso wohlfühlten wie die Auerochsen; aus bisher
nicht ganz geklärten Gründen verschwanden einige dieser wertvollen Tiere, so dass der
Münchner Tierpark Hellabrunn als Eigentümer die Pferde im Frühjahr 2004
wieder zurücknahm. Seit Frühjahr 2006 leben nun mehrere Exemplare der seltenen Exmoor-Ponys
im Auerbacher Naturschutzgebiet "Grubenfelder Leonie".
Doch blicken wir nun zurück in die reiche Geschichte des Auerbacher
Eisenerzbergbaus.
Die
ältesten Zeugnisse
Große Anziehungskraft übte sicher schon sehr früh das in und um Auerbach
anzutreffende, in der Kreidezeit
entstandene Eisenerz
aus. Auch wenn größere Ansiedlungen bisher nicht
nachgewiesen werden konnten, lebten doch schon lange bevor Auerbach in die
geschriebene Geschichte eintrat zumindest vereinzelt Menschen in dieser Gegend,
wie Funde aus verschiedenen Epochen beweisen: aus der Mittleren (8000-4000 v.
Chr.) und der Jüngeren Steinzeit (4000-1800 v. Chr.) bei
Weidlwang und Ranna;
aus der Bronzezeit (1800-1200 v. Chr.), aus der
Urnenfelderzeit
(1200-750 v.
Chr.) und aus der Eisenzeit (800 v. Chr. bis Christi Geburt) am
Maximiliansfelsen im sog. Birkenschlag, wo wohl ein Kultplatz war, der
vielleicht jahrtausendelang von unseren Vorfahren als vorchristliche Opferstätte
genützt wurde.
 |
Häufig findet man auch die Bezeichung
Maximilianswand für die gewaltige
Felsformation.
Es ist gar nicht möglich, ein Gesamtfoto
des Felsmassivs zu machen.
Im Luftbild
wird seine Lage
und Ausdehnung angedeutet.
(Foto Mai 2012) |
Aus der Eisenzeit mit ihren verschiedenen Unterteilungen (ältere Eisenzeit oder
Hallstattzeit 800-450 v. Chr. und Jüngere Eisenzeit oder
Latenézeit, auch
Keltenzeit genannt, 450 v. Chr. bis Christi Geburt) wurden mehrere
Grabhügelfelder
von Laien angegraben und z. T. regelrecht geplündert: 9 Grabhügel in der Flur
Reut im Oberen Wellucker Wald (nordöstlich von Sackdilling, heute im
Truppenübungsplatz
liegend), 5 Grabhügel in der Flur Weißer Brunnen über dem Ohrental (südöstlich
von Lehnershof) und über 30 Grabhügel auf der Bloa und im Seideloheholz (östlich
von Ortlesbrunn).
Johannes Neubig schrieb wohl mit Recht über die Entstehung der Stadt:
„Bergleute gruben daselbst Auerbach aus und Schmiede hämmerten den kleinen
Anfang zur festen Dauer des Fortbestehens.“ (2, Seite 4)
Auch der Name des Ortsteiles Welluck, in dessen unmittelbarer Nähe die
weiter unten aufgeführte Grube Maffei stand, weist deutlich auf
Eisenverarbeitung hin: „wellen“ bedeutet soviel wie „wallen machen, kochen
machen, sieden“, eben „Eisen schmelzen“, und „luck“ kennen wir noch in
der Mundartform „Luch“ für „Loch“; so war also „Welluck“ wohl ein
Ort, wo ein „Schmelzloch“ für die Eisengewinnung stand.
(nach 3, Seite 82 f)
Schriftliche
Belege
Schon in Salbüchern der Jahre 1275 und 1326 wird von „Feuern“ in und um
Auerbach gesprochen.
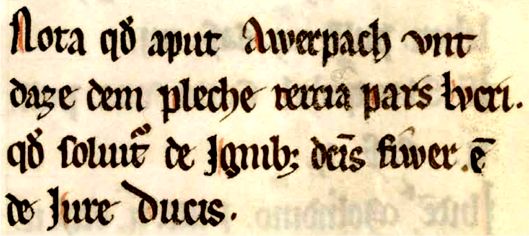
Im Urbarium Baiuwariae transdanubianae
um 1275 heißt es: "Nota quod aput Awerpach unt daze dem Pleche tercia pars
lucri, quod solvitur de ignibus dictis fiwer, est de jure ducis." (deutsch
etwa: beachte, dass der dritte Teil des Gewinns, der mit den Feuern bei Auerbach
und Plech erzielt wird, rechtmäßig dem Herzog gehört) (nach 4, Seite
36, Anm. 1 und 3, Seite 82)
Hier handelt es sich wohl um den ältesten bisher bekannten Beleg über
Eisenverarbeitung im Raum Auerbach und bei Plech.
In einem Flurstück, genannt In der alten Welluck (am
Gottvaterberg gegenüber den Maffei-Türmen) wurde lt. einer Urkunde 1520 ein
neues Bergwerk eröffnet. Dessen Erz wurde vielleicht in einem Hammer im nahen
Nitzlbuch verarbeitet; nach Aussagen des bereits verstorbenen Besitzers von Haus
Nr. 14 (beim Koiser) stieß man bei Arbeiten auf diesem Anwesen um 1950 auf große
Schlackenmengen, die man verkaufte und zum Straßenbau verwendete.
Im Salbuch von 1326 wird ein „malleum Pognarii“, ein Hammer des Pogner,
aufgeführt, der sicher im Bereich der heutigen Bognersiedlung stand, da man in
diesem Gebiet auch jetzt noch bei Erdarbeiten auf Sinterhaufen stößt. Aus dem
15. und 16. Jahrhundert wird auch von Erzgruben berichtet, die bei heute im
Truppenübungsplatz Grafenwöhr liegenden Orten wie Pappenberg, Hopfenohe und
Ebersberg angelegt waren.
"Die durch Privatpersonen und einheimische
Gewerkschaften betriebene Eisengewinnung drohte schließlich zum Erliegen zu
kommen, als im Jahr 1858 der Hammer Rothenbruck, im Jahr 1860 die Hammerwerke
Ranna, Fischstein und Hammerschrott, im Jahr 1861 die Hämmer Hammergänlas und
Langenbruck, 1863 Altneuhaus, 1864 Heringnohe, 1865 Hellziechen und 1866
Altenweiher ihren Betrieb einstellten."
(Pfeufer, Johannes, Beitrag zur Geschichte des
Eisenerzbergbaus von Auerbach (Opf.), in Festschrift 90 Jahre
Bergknappenverein und 75 Jahre Bergknappenkapelle Auerbach, Auerbach 1979
(ohne Seitenzahlen))
Die
Maxhütte im Raum Auerbach
Am 26. August 1857 genehmigte die KgI. Generalbergwerks- und
Salinenadministration München die Belehnung des Hofrates Dr. Friedrich von
Kersdorf in Augsburg und des Rentiers Oliver Goffard in München mit dem
Grubenfeld Leonie (Richtung Dornbach). Sie
betrieben dort die Gruben Elisa und Maria, allerdings wohl mit
wenig Erfolg. 1868 kaufte der Nürnberger Theodor von Cramer-Klett
das Bergwerk, in dem ca. 70 Mann beschäftigt waren.
Am 14.
Dezember 1878 übernahm dann die Maxhütte die sich im Aufbau befindliche
Grube Leonie I, und
begann mit dem Abbau von Eisenerz.
Die
Auerbacher Eisenerzlagerstätten
1bk.jpg)
Im Raume Auerbach gibt es zwei große
Kreideerz-Lagerstätten, nämlich Leonie (A) und Nitzlbuch (B). Der Beginn des
Eisenerzabbaus durch die Maxhütte 1878 (Leonie I) und deren letzte Grube (Schließung
Leonie IV 1987)
waren jeweils im Feld Leonie.
Der Name Leonie, den ja auch das heutige Naturschutzgebiet
träg, geht wohl auf die Schwester des oben genannten Kersdorf zurück, die Leonore (Koseform Leonie) hieß.

Die erste Grube der Maxhütte in unserem Raum,
Leonie I
genannt, befand sich in der Nähe des heutigen Wasser- und ursprünglichen
Sandlochs Alter Schacht
an der Straße nach Dornbach. Gefördert wurde hier in insgesamt drei Gruben von 1878 bis 1921. Das
Spateisenerz (Weißerz) wurde, um den Fe-Gehalt von ca. 25-35 % um 10 % zu
erhöhen, in großen hochofenähnlichen Röstöfen geröstet. Dann wurde es mit
Pferdefuhrwerken und Ochsenkarren zur Bahnstation Ranna gebracht. Dort wurde das
Eisenerz auf Eisenbahnwaggons umgeladen und über Hersbruck nach
Sulzbach-Rosenberg zum Hochofen transportiert.

Die Bahnlinie
Nürnberg-Bayreuth über Neuhaus und Ranna war 1867-77 gebaut
worden, die Strecke von Nürnberg nach Amberg und Schwandorf
über Hersbruck und Sulzbach-Rosenberg gibt es schon seit 1859.

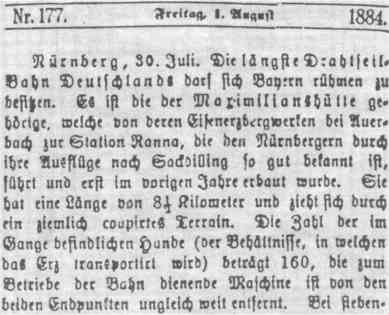 |
1883 ließ die Maxhütte
eine Drahtseilbahn
(Längste Drahtseilbahn Deutschlands)
von der Grube Leonie
zum Bahnhof nach Ranna
errichten, die das Erz dorthin
bis 1903 beförderte. |
Von Ranna aus erfolgte dann der
Weitertransport nach Sulzbach-Rosenberg zum Hochofen wie bisher mit der Eisenbahn.
Beim heutigen Gasthof Hohe Tanne
stand eine Dampfmaschine, die den Antrieb besorgte.
Von 1903 bis zum April 1970
wurde das Erz knapp sieben Jahrzehnte auf der nicht zuletzt wegen des
Erztransports gebauten Lokalbahnstrecke von Auerbach nach
Ranna gefahren.
 |
Dabei
wurde das Eisenerz zunächst
vom Förderschacht Nitzlbuch (Maffei)
mittels einer Drahtseilbahn
über den
Gottvaterberg
zu
der links abgebildeten Verladestation
(heute Wohnbaugebiet neben dem Lagerhaus
in der Dornbacher Straße) transportiert und
dort auf
Eisenbahnwaggons umgeladen.
|
Ab dem
Frühjahr 1970 bis zum Schluss des Eisenerzabbaus beförderten werkseigene LKWs
den Bodenschatz von der Verladestelle neben dem Förderschacht über die B 85
direkt zum Hochofen nach Sulzbach-Rosenberg,
wo der Bergbau schon ein Jahrzehnt früher (1977) als in Auerbach (1987)
eingestellt wurde.
Minister Falk und
die
Maffeischächte im Grubenfeld Nitzlbuch
Da man zur Verhüttung in Rosenberg (erst 1934 wurden die Stadt Sulzbach und der
Hüttenstandort Rosenberg zusammengelegt) mehr Erz benötigte, erfolgte am 22. August
1900 der 1. Spatenstich für die geplante Doppelschachtanlage Leonie II an der
Straße nach Dornbach nordöstlich der sog. Schwanenwirtskapelle. Ein gewaltiger
Schwimmsandeinbruch brachte dieses
Projekt schon 1904 zum Erliegen; im Volksmund spricht man von den Millionenschächten.
Parallel zu Leonie II wurde in weiser Voraussicht bereits in den Jahren
1901-1903 am Fuße des Gottvaterberges in der Flur „In der alten Welluck“
der Schacht Minister Falk auf 60 Meter abgeteuft. Unmittelbar hinter den
ehemaligen Steigerhäusern kann man heute an dieser Stelle noch ein Gebäude
sehen, das viele Jahre lang zur Wasserversorgung verwendet wurde.
Beim Abteufen und Abbau von Minister Falk kam man zur Erkenntnis, dass infolge einer
tektonischen Verschiebung südwestlich davon tiefer noch größere Erzvorkommen
lagern müssten im sog. unteren Lager. Deshalb begann 1904 die Errichtung der Doppelschachtanlage
Maffei I und II, benannt nach Dr. Hugo Ritter von Maffei, der 1882-1921
Aufsichtsratsvorsitzender der Maxhütte war.
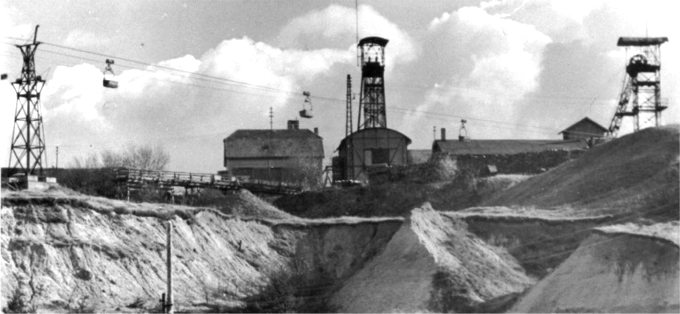
Diese alte Aufnahme (um 1930) zeigt die
Doppelschachtanlage Maffei. Der linke Turm Maffei 1 war der Förderschacht
für das Eisenerz und hatte einen rechteckigen Querschnitt (2 mal 3 m); Maffei
2 (rechts) mit gleicher Tiefe (137 m) war rund gemauert, hatte einen
Durchmesser von 7 m und diente dem Personen- und Materialtransport.
Im Vordergrund wurde der Sand abgebaut, mit dem im Spülverfahren in den ersten
Jahren, in denen das Erz von unten nach oben abgebaut wurde, die ausgeerzten
Stollen wieder verfüllt wurden. Dieses Verfahren im Querbau von unten
nach oben mit Spülversatz betrieb die Maxhütte in Auerbach bis 1911.
(nach 5, Seite 338)
Mit im Bild ist auch die Drahtseilbahn, mit der das geförderte Eisenerz bis
1970 über den Gottvaterberg zur Verladestation am Bahnhof gebracht wurde. Dort
wurde es in Eisenbahnwaggons verladen und über Ranna und Hersbruck zum Hochofen
nach Sulzbach-Rosenberg gefahren.
 |
Neben dem "normalen" Eisenerz
kamen auch immer wieder
besonders schöne Stücke zum Vorschein.
Viele
ehemalige Bergleute und andere Auerbacher
haben sich davon kleine
Sammlungen angelegt.
Eines dieser besonderen Exemplare aus der Grube Maffei
befindet
sich seit
Oktober 2007 im Rathaus
der polnischen Stadt Oświęcim
(Auschwitz)
und soll dort in den entstehenden Gedenk- und Versöhnungshügel
integriert werden. |
Auch die Erzbrocken des Eisenerzaltars (siehe
weiter unten) in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer stammen aus dem
Auerbacher Bergwerk.
Aus der Grube Nitzlbuch, wie die offizielle Bezeichnung lautet, mit einer tiefsten
Stelle von 141 Metern, wurden bis zur Stillegung am 29. Juli 1978 ca. 16
Millionen Tonnen Erz (überwiegend Braunerz
und Weißerz) gefördert, was Maffei zum bedeutendsten Einzel-Erzbergwerk
im bayerischen Raum werden ließ.
Bergbaumuseum
Maffeischächte

Während die Schächte selber mit
Kalksteinschotter verfüllt wurden, erinnern die ehemaligen Fördertürme und Teile
der Schachtanlage als Bergbaumuseum an den
untergegangenen Eisenerzbergbau.
Hier werden u. a. verschiedene Abbaumaschinen und bergmännische Gerätschaften
(Geleucht
usw.) gezeigt.
Unmittelbar neben den Maffeitürmen (rechts vorne) steht das
ehemalige Schützenheim von "Unter Uns" Nitzlbuch, das heute in
privatem Eigentum ist.
 |
Auf dem stillgelegten
Bergwerksgelände
haben ehemalige Bergleute
einen Stollen errichtet,
der sogar von einer
alten Grubenbahn
befahren wird. |
Der sehr rührige Förderverein
"Maffeispiele Auerbach e.V." ist Träger des Museums. Zur Erinnerung an den Bergbau in
Auerbach organisiert er mittlerweile jährlich die Reihe Kultur im Sommer und im Dezember
den Grubenadvent.


Näheres über den Bergbau erfährt man
hier,
eine Erklärung bergbautechnischer Begriffe und die Bergmannssprache
hier.

Die
Kolonie, heute Maffeistraße
Angesichts des raschen Aufschwungs durch die Maffei-Schächte und veranlasst
durch die Sorgen und Nöte der Arbeiter errichtete die Maxhütte in den Jahren
1906-1911 für ihre Belegschaftsmitglieder insgesamt 17 Wohnhäuser mit
damals jeweils sechs Wohneinheiten.

Bis zum Jahre 1975 trugen sie die Anschrift
Kolonie, seither Maffei-Straße.
 |
Überwiegend Werksangehörige haben die Häuser
inzwischen käuflich erworben und größtenteils den heutigen Bedürfnissen
entsprechend auch umgebaut und modernisiert; dadurch allerdings ging das charakteristische Aussehen der
Auerbacher Bergarbeitersiedlung
verloren. |
Das schmucke Wohnhaus für den Betriebsleiter der Grube wurde ebenfalls 1906 im
unmittelbaren Anschluss an die Bergarbeiterhäuser errichtet und gehört nun der
Familie von Bergassessor Professor Dr.-Ing. Dr. h.c. Johannes Pfeufer (+
14.6.2006), der von 1967 bis zum bitteren
Ende den Gruben Maffei und Leonie in Auerbach vorstand.
Die
Bergknappen und ihre Schutzpatronin
Aus dem kulturellen Leben der Stadt nicht wegzudenken ist der Bergknappenverein,
einer der ältesten (gegründet 1890) und größten Vereine Auerbachs. Bei
Beerdigungen von Bergleuten, bei kirchlichen und weltlichen Festen ziehen die Männer
in ihren schicken und traditionellen Uniformen, angeführt von der weithin bekannten
Bergknappenkapelle, durch die Straßen der Stadt. Das Hauptfest der Bergleute
ist jährlich die Barbarafeier. Seit 1860 wird das dem 4. Dezember am nächsten
liegende Wochenende in Auerbach festlich begangen. Dabei wird natürlich auch
das Steigerlied
gesungen.
Die hl. Barbara ist bekanntlich die Patronin der Bergleute. Es ist daher nicht
verwunderlich, dass an vielen Stellen der ganzen Umgebung diese Heilige
besonders verehrt wird. So weihte am 30. Oktober 1384 der Bamberger Bischof
Heinrich die Spitalkirche in der Unteren Vorstadt zu Ehren der hl. 14 Nothelfer,
insbesondere der hl. Katharina und Barbara. Von letzterer wurde lt. Weiheurkunde
als Reliquie ein Knochenteil im Altar versenkt. Dieses in seiner wesentlichen
Bausubstanz noch im ursprünglichen Zustand erhaltene Kirchlein ist wohl das älteste
christliche Heiligtum der Gegend. Die Barbarastatue auf dem Hauptaltar stammt
wie der größte Teil der Inneneinrichtung aus der Zeit um 1735-42 und wurde
wahrscheinlich vom Auerbacher Bildhauer Johann Michael Doser angefertigt. Die
Kirche und das dazugehörende Bürgerspital (heute ein modernes Altenwohnheim)
sind eine Stiftung reicher Auerbacher Bürger aus dem 14. Jahrhundert, der Blütezeit
der Stadt, die nicht zuletzt auf den Erzbergbau und den Eisenhandel zurückzuführen
ist.
Eine sehr schöne Barbarastatue befindet sich auch in der Michelfelder Asamkirche
(Patron St. Johannes der Evangelist) an der rechten Seitenwand des
St.-Otto-Altares, gleich hinter dem herrlichen schmiedeeisernen Gitter, welches
sicher von Hammerschmieden der Umgebung stammt. Diese Barbara ließ Abt
Rinswerger (1707-21) durch Egid Asam anfertigen, während sein Bruder Cosmas
Damian Asam die Fresken und das Hochaltarbild schuf.
In der Auerbacher Pfarrkirche (Patron St. Johannes der Täufer) zeugen gleich
zwei Barbarastatuen von der großen Verehrung für die Heilige. Die eine davon,
fast lebensgroß, steht am hinteren rechten Langhauspfeiler und stammt ebenso
wie der Aufbau des Barbaraaltares links von J. M. Doser um 1730. Die Figur auf
diesem Altar ist älteren Ursprungs, nämlich eine hervorragende Arbeit aus dem
15. Jahrhundert. Sie stand schon auf dem Barbaraaltar, auf welchem lt. Urkunde
vom 18. Mai 1435 der Prediger dreimal in der Woche eine Messe lesen sollte.
Eine sehr schöne, von einem zeitgenössischen Künstler gefertigte
Barbarastatue war in der Knappenstube des früheren Hotels Goldner Löwe zu sehen; dieser
Raum erinnerte wegen seines Ausbaus mit Eisenerzbrocken stark an den Untertagebergbau,
und war deshalb sehenswert. (Leider "war", denn das Hotel Goldner Löwe existiert
nicht mehr!)

Auf dem Auerbacher Friedhof
beim Eingang zur
Kirche (nahe Kriegerdenkmal) hat diese neuzeitliche Barbarastatue ihren Platz gefunden,
nachdem sie vorher im Verwaltungsgebäude des Bergwerks aufgestellt war.
Seit 1951 hängt eine Barbaraglocke im Auerbacher Kirchturm und erinnert durch
ihr Läuten ebenfalls an die hiesige Bergbautradition. Weitere Zeugnisse für
die große Verehrung der Schutzpatronin der Bergleute findet man darüber hinaus
in vielen Orten der Umgebung, und auch ehemalige Bergleute besitzen solche. In
diesem Zusammenhang sei auch auf den Barbaraberg
bei Speinshart verwiesen.

Die
Stromer in Auerbach
Wegen des Erzes und des Eisens hatten angesehene Nürnberger
Patriziergeschlechter im „Ruhrgebiet des Mittelalters“, wie die Oberpfalz
zeitweilig bezeichnet wurde, und somit auch in Auerbach Wohnsitze. Der
bekannteste Name ist hier Stromer oder Stromeier, erstmals nachgewiesen im Neuböhmischen
Salbüchlein von 1366-68.
Ein Ebberl Stromer ist der erste namentlich bekannte
Besitzer des Anwesens Unterer Markt 4 und damit auch des sehr interessanten, in
den letzten Jahren leider zum Großteil abgerissenen Rückgebäudes, dessen Überreste
man von der Apothekergasse aus noch sehen kann. Dieses wohl älteste zumindest
teilweise noch erhaltene Gebäude der Stadt wurde um 1200, wie sollte es auch
anders sein, mit eisenhaltigen Bruchsteinen erbaut. Ein Blick auf eine
Lageskizze Auerbachs zeigt, dass dieser so genannte „Stadel“ als Burg des
Stadtherrn außerhalb des ursprünglichen kreisähnlichen Stadtkerns stand; eine
für Städte und Märkte der damaligen Zeit normale und häufiger anzutreffende
Bauweise.
Auerbach war ja 1144 auf eine etwas eigenartige Weise Markt geworden:
die Mönche des 1119 gegründeten Benediktinerklosters Michelfeld fühlten sich
in ihrer Ruhe gestört und verlegten das Markttreiben deshalb in das nahe gelegene
Dorf Urbach, auf welches bald darauf auch das Marktrecht von
Hopfenohe, einem bei der Truppenübungsplatzerweiterung 1937/38 aufgelösten
Ort, übertragen wurde.
Die, man kann ruhig sagen, romanische Burg in Auerbach war bis 1620 im
unmittelbaren Besitz der Stromer, denen u. a. auch die Hämmer in Steinamwasser,
Rauhenstein und Fischstein neben vielen anderen Gütern gehörten. Im
historischen Sitzungssaal des Rathauses findet man an der Nordseite das Wappen
der Stromer.
 |
Der bekannteste Spross
des Auerbacher Zweiges
ist sicher Dr.
Heinrich Stromer.
An ihn erinnern hier
in seiner Geburtsstadt Auerbach
eine schlichte Gedenktafel
am Haus Nr. 10 am Oberen
Marktplatz,
die Dr.-Heinrich-Stromer-Straße
und die 1989 vom Rotary-Club
gestiftete Büste am Aufgang
vom Marktplatz zur Pfarrkirche.
(Bild von 1527)
|
Heinrich
Stromer war Rektor der Universität Leipzig und eröffnete in jener sächsischen
Stadt 1532 das Weinlokal Auerbach's Keller, welches durch Goethes Faust I (Verse
2073-2336} in die Weltliteratur Eingang gefunden hat.

Eisenerzaltar
in der Auerbacher Pfarrkirche
Aus unseren Tagen sollen künftige Generationen an den ehemaligen Bergbau in
Auerbach u. a. durch Namen wie Bergknappenstraße, Glückaufstraße oder SC Glückauf
erinnert werden.
Ein anderes, ganz besonderes Denkmal an exponierter Stelle ist der Eisenerzaltar
in der Auerbacher Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer.
 |
„Das weltweit
einmalige Kunstwerk
erinnert an den Bergbau,
der den Menschen hier
etwa 1.000
Jahre lang
den Lebensunterhalt sicherte.
... Der Altar krönt
die Geschichte der
Bergleute
und hebt ihre gläubige Verbundenheit
mit der Kirche hervor.“
(St. Heinrichsblatt Nr. 4 1993,
Bamberg)
|
Dieser Altar steht im Chorraum der Auerbacher Pfarrkirche und wurde am 17.
Januar 1993 vom damaligen Bamberger Erzbischof Elmar Maria Kredel (1977-94)
konsekriert. Er enthält aus der Grube Leonie gefördertes Eisenerz in
verschiedenen Formen: an der Unterseite der Tischplatte kann man die Erzbrocken
praktisch unbehandelt sehen, im Altarfuß und am Ambo sind sie geschnitten und
glatt, und auf der Oberseite des Altartisches geschliffen und poliert.
Selbstverständlich gibt es in Auerbach und seinen
Ortsteilen noch weitere Zeugnisse für den Bergbau und die Eisenverarbeitung in
alter und neuer Zeit, und der aufmerksame Sucher wird sicher auch einige davon
erfreut entdecken.
Wer mehr über die Oberpfälzer Montangeschichte erfahren und vor allem erleben
möchte, dem sei eine Wanderung
auf historischen Wegen empfohlen. (Bergmännische
Links)
verwendete
und weiterführende Quellen
| 1 |
Archiv
Köferl Erna, Auerbach |
| 2 |
Neubig,
Johannes, Auerbach, die ehemalige Kreis- und Landgerichtsstadt in der Oberpfalz,
Auerbach 1836 |
| 3 |
Schnelbögl, Fritz, Auerbach in der
Oberpfalz, Auerbach 1976 |
| 4 |
Stark, Heinz, Plecher Kirchengeschichte im
Mittelalter, Sonderheft 49 der Mitteilungen der Altnürnberger Landschaft
(ANL), Simmelsdorf 2002 |
| 5 |
Pfeufer,
Johannes,
Entwicklung der Abbauverfahren im Eisenerzbergbau von Auerbach/Opf., in
Erzmetall Band 25, Stuttgart 1972 |
|
Helml, Stefan, Die Maxhütte - Bergbau
in Sulzbach-Rosenberg und Auerbach, Amberg 1989 |
|
Agricola, Georg, Vom Berg- und Hüttenwesen,
dtv-Reprint, Nördlingen 1994 |
|
Hafer,
Karl, Kleine Bergbaukunde des Erzbergbaus, Halle (Saale) 1953 |
|
100
Jahre Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte, Festbuch 1953,
Sulzbach-Rosenberg 1953 |
|
Pfeufer, Johannes, Beitrag zur Geschichte des
Eisenerzbergbaus von Auerbach (Opf.), in Festschrift 90 Jahre
Bergknappenverein und 75 Jahre Bergknappenkapelle Auerbach, Auerbach 1979
(ohne Seitenzahlen) |
|
Pfeufer,
Johannes,
Entwicklung der Abbauverfahren im Eisenerzbergbau von Auerbach/Opf., in
Erzmetall Band 25, Stuttgart 1972 |
|
Pfeufer, Johannes, Der Oberpfälzer
Eisenerzbergbau nach dem Zweiten Weltkrieg, Bochum 2000 |
|
Graf, Alfred, Erzbergbau in Auerbach, in Festschrift 100 Jahre Bergknappenverein Auerbach i.d.OPf.
1890-1990, Auerbach 1990 |
|
Die Oberpfalz, ein europäisches
Eisenzentrum, Band 12/1 (Aufsatzband) der
Schriftenreihe des Bergbau- und Industriemuseums Ostbayern in Theuern,
Theuern 1967 |
|
Die Oberpfalz, ein europäisches
Eisenzentrum, Band 12/2 (Katalog) der Schriftenreihe
des Bergbau- und Industriemuseums Ostbayern in Theuern, Theuern 1967 |
|
Die Bergbauabteilung, Das Projekt Bayerische
Eisenstraße, Band 2 der Schriftenreihe des Bergbau-
und Industriemuseums Ostbayern in Theuern, Theuern (ohne Jahrgang) |
|
Götschmann, Dirk, Oberpfälzer Eisen
- Bergbau- und Eisengewerbe im 16. und 17. Jahrhundert, Band 5 der
Schriftenreihe des Bergbau- und Industriemuseums Ostbayern in Theuern,
Theuern 1985 |

sehenswerte Bergbaumuseen usw.
https://bayerische-eisenstrasse.de/bergbaumuseum-maffeischaechte.html
https://www.bergbaumuseum-oelsnitz.de/ (sächsischer Steinkohlebergbau)
https://www.salzbergwerkwieliczka.de/ (Salzbergwerk in Südpolen,
Weltkulturerbe)
https://kultur-schloss-theuern.de/ (Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern)

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 8. Mai 2024


|
Für Ergänzungen, Korrekturen usw.
bin ich sehr dankbar.
Hier können Sie mich erreichen!
|

|
 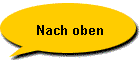 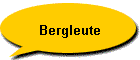  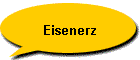  |