|
| |
Sackdilling
ehemals Forst- und Gasthaus

„Wer an einem verkehrsstillen Werktag auf langer
Waldstraße von Königstein oder Auerbach oder von Ranna kommend, erstmals dem
weißen Forsthaus in der kleinen Waldlichtung begegnet oder wer gar nach mühevoller
Wanderung auf dem vielgerühmten ,,Exkursionspfad“ sich nach gastlicher Stätte
sehnt, der wird gestehen, daß, wenn irgendwo, so hier das vielgebrauchte und
vielmißbrauchte Wort vom „Waldidyll“ seine Berechtigung hat.“ (1)
Diese Worte
stammen von Fritz Schnelbögl, dem Verfasser der Auerbacher Chronik. Er schrieb
den sehr
interessanten Artikel über Sackdilling im Januar 1937. Das oben gezeigte Foto
dürfte auch etwa aus dieser Zeit sein.
Auch Chronist Joseph Köstler schwärmte schon kurz nach 1900: „Von 1860 bis 85 war
Sackdilling ein vielbesuchter Ausflugsort. Der herrliche Wald, die romantischen
Felsgruppen, der prächtige Excursionsweg zur Krottenseer Tropfsteinhöhle
(gemeint ist die Maximiliansgrotte) sind
ja Magnete mit gewaltiger Anziehungskraft. An schönen Sommertagen, besonders am
Pfingstmontag, kommen Hunderte von Touristen nach Sackdilling.“ (2, Seite 456)

Leider ist die beliebte Gaststätte in Sackdilling seit Frühsommer 2009 geschlossen.

1ak.jpg)
Für die damalige Zeit war eine Kegelbahn im
Freien ein echter Anziehungspunkt. Sackdilling hatte eine solche, wie diese
Ansichtskarte aus der Zeit um
1900 zeigt.
Auch in unseren Tagen wissen viele
Einheimische und zahlreiche
Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung, die „Waldidylle“ und - bis
zur Schließung 2009 - die
gepflegte Gastlichkeit des „Forsthauses Sackdilling“ zu schätzen.
Sackdilling gehörte bis 1978 zur Gemeinde Nitzlbuch,
und kam mit dieser zum 1. Mai 1978 zur Stadt Auerbach in der Oberpfalz. Die
Einöde
liegt
knapp 5 km südlich des Auerbacher Rathauses im Wellucker Wald.
Die nur wenige Hundert Meter entfernte B85 muss westlich des Anwesens den
Allmannsberg umgehen.
Frühe Besiedelung
Schon in sehr früher Zeit siedelten in der Gegend um Sackdilling Menschen, wie
zahlreiche Funde zeigen. So wurde 1958 beim Maximiliansfelsen
im Wellucker Wald, Abt. Birkenschlag,
(ca. 2 km südwestlich von Sackdilling; Höhenangabe 515,9) ein bedeutendes Bodendenkmal mit
zahlreichen Scherben von Gefäßen gefunden.
 |
Der Maximiliansfelsen,
bei den zahlreichen Kletterern auch
Maximilianswand genannt,
ist ein ganzes Massiv aus Felsen.
Ein einzelnes Foto kann seine Größe
gar nicht darstellen. Dieses Luftbild
aus dem BayernViewer lässt
das Ausmaß (rund um Höhe 515,9)
ein wenig erahnen. |
Die ältesten
beim Maximliansfelsen gefundenen Stücke stammen aus
der Jungsteinzeit (ca.
5.000 - 2.000 v. Chr.), der anschließenden
Bronzezeit
(ca. 2.200 - 1.200 v. Chr.) und den folgenden Epochen Urnenfelder- (ca. 1.200 -
750 v. Chr.) und Eisenzeit (ca. 800
v. Chr. bis zu Christi Geburt). Bei dieser
Fundstelle handelt es sich wohl um einen Kultplatz, vielleicht eine Opferstätte,
die, wenn auch nicht ununterbrochen, jahrtausendelang benützt worden sein dürfte.
In der Flur „Reut“ im Oberen Wellucker Wald, ca. 1 km nordöstlich von
Sackdilling, wurden aus mehreren Grabhügeln Bronzeringe, Fibeln, Broschen usw.
aus der Älteren Eisenzeit (Hallstattzeit ca. 800 - 450
v. Chr.) und der Jüngeren
Eisenzeit (Latenezeit oder Keltenzeit, ca. 450
v. Chr. - Christi Geburt)
geborgen.
Hier soll auch eine Grube, die zum Schmelzen von Eisen diente,
entdeckt worden sein; dies wäre wohl der älteste Nachweis für die Erzverhüttung
in unserem Raum. Die Stelle liegt im Truppenübungsplatz Grafenwöhr.
 |
Knapp 500 m südlich des
ehemaligen Forst- und Gasthauses
liegt
das Felsenlabyrinth.
Die Markierung mit gelbem Querstrich
führt uns dorthin.
Rechter Hand liegt der Eingang
zum kleinen Bauernloch.
In dieser Höhle mit einer Gesamtlänge
von ca. 35 m wurden 1911
"menschliche Skelettreste, Gefäßkeramik,
Spinnwirtel und
eine eiserne Axt
entdeckt." (6, Seite 53f) Aus diesen Funden
könnte man schließen, dass sich hier
vor allem Frauen versammelten,
um ihren
speziellen Gottheiten zu huldigen.
Die Felsbärbel, ein "Kräuterweibl",
soll bis 1927 hier gelebt haben. |
Ortsname
Joseph Köstler schreibt: „Den sonderbaren Namen Sackdilling leite ich
von Sankt Ottilien ab. Diese Heilige erwies sich früher besonders bei
Augenkrankheiten sehr hilfreich und bekam von dankbaren Patienten häufig ein
Weihegeschenk (ein geschnitztes Bild oder eine Figur aus Wachs), das man in
Ermangelung einer Kapelle an einen markanten Baum heftete. Diesen „Bildbaum“
und seine Umgebung nannte man Sankt Ottilien und durch korrupte Aussprache
entstand daraus nach und nach das Wort Sackdilling.“ (2, Seite 456) Köstler
hatte wohl bei seiner Namensdeutung auch folgende alte Volkslegende im Ohr:
„Einst befand sich dort eine dem hl. Ägidius geweihte Wallfahrtskapelle, St.
Gilgen genannt, die durch das Ausbleiben der Wallfahrer immer mehr verfiel.
Eines Tages kam ein armer fremder Kohlenbrenner, der in seiner Heimat Hab und
Gut verloren hatte, in die Gegend und beschloß, in der Nähe dieser Waldkapelle
eine Hütte zu bauen. Da er ein frommer Mann war, verrichtete er in dem
halbverfallnen Kirchlein jeden Tag seine Gebete. Als er dann eines Tages ein
altes Bild der hl. Ottilia (Odilia) an einem Baum entdeckte, nahm er es zu sich,
hing es in seinem Wohnraum auf und hielt nun vor ihm seine Andachten. An
Sonntagen schmückte er das Bildnis mit Tannenreis und Waldblumen. Als er einmal
schwer erkrankte und die hl. Odilia um Hilfe und Fürbitte anrief, wurde er über
Nacht plötzlich gesund. Bald verbreitete sich die Nachricht von der raschen
Heilung in der ganzen Gegend. Nun wurde diese Stätte wieder das Ziel vieler
Wallfahrer.“ (aus „Die Oberpfalz“, 1923)
 |
Das große
Bauernloch, auch
unweit vom ehemaligen Gasthaus
Sackdilling
gelegen, weist ebenfalls auf
frühe Nutzung durch Menschen hin.
Die Höhle ist über 60 m lang
und bis auf wenige Meter
so hoch, dass sie aufrecht
begangen werden kann. |
Schnelbögl dagegen geht die Frage nach dem Ortsnamen wissenschaftlich an und stellt klar: „Aus
dem Jahre 1499 ist mir viermal die Überlieferung „die Wiese, genannt die
Sackdietlin“ bekannt. Von dieser Schreibung müssen wir ausgehen, denn die
Umwandlung in Sackdilling erfolgte erst im 18. Jahrhundert in Anlehnung an
andere -ing-Orte wie Schniegling, Heuchling. Ich erinnere nun daran, daß die
Wiesen früher ungemein häufig Namen mit der Endung -in erhielten, und zwar so,
daß eine Wiese, die einem gewissen Schütz gehörte oder von ihm stammte,
einfach als „Schützin“, die Wiese, die einem Meier gehörte, als „Meierin“
bezeichnet wurde. Die Pfarrei Neunkirchen a.S. erwarb im Jahre 1507 von den Brüdern
Fritz, Hans und Georg Eppenauer eine Wiese bei Speikern. Später nannte man
diese Wiese die „Eppenauerin“. Eine andere Wiese, die man von einem Haus
Kopp gekauft, hatte, hieß man die „Köppin“. Aus vielen Orten wird man
solche Beispiele beitragen können. So erklärt sich auch zwanglos Sackdietlin
als Wiese eines Sackdietel, als Wiese eines Dietel (Kurzform für Dietrich oder
Diether) Sack.
Weder eine heilige Ottilia noch ein heil. Egidius sind für den Namen des Ortes
verantwortlich. Vielleicht stand bei der Bildung dieser Legenden, die übrigens
erst aus dem 19. Jahrhundert stammen dürften, folgende Erinnerung Pate: Nicht
allzuweit entfernt von Sackdilling, in der Ortsflur Pommershof, am Wege, der von
Auerbach nach Kürmreuth führt, befand sich vorzeiten eine Kapelle. An diesem
Wege liegt nun eine Flur „Gilgensee“. Man darf annehmen, daß dieser
Gilgensee so viel bedeutet wie Egidiensee, ähnlich wie in Nürnberg der
Gilgenhof der St. Egidienhof, die Gilgengasse die St. Egidiengasse ist. Also
wird die Kapelle bei Pommershof eine Egidienkapelle gewesen sein. Lediglich die
Erinnerung an diese benachbarte Kapelle mag dann die Erklärung des Namens
Sackdilling mit „St. Egidien“ und ein ähnliches Mißverständnis die
Deutung mit „St. Ottilien“ veranlaßt haben.“ (3, Seite 69f)
Kürzer drückt es Schnelbögl, der ehemalige Leiter des Staatsarchivs
Nürnberg, so aus: "Die hübsche Siedlung im Wald ist erst i.J. 1595 ins
Leben getreten. Damals und schon im 15. Jahrhundert hieß der Platz Sackdietlin,
hat also nichts mit den alten Ortsnamen auf -ing zu tun. Der Name bedeutet Wiese
des Dietel Sack." (4, Seite 27)

Erster Hof vor 400 Jahren
Der Flurname „Sackdietlin“ ist schon aus dem ausgehenden 14. Jahrhundert überliefert,
die erste Nachricht über ein dort errichtetes Gebäude stammt erst von 1595
bzw. 97. Damals erhielt der Auerbacher Landrichter Clas Henrich von Eberbach von
der kurfürstlichen Regierung in Amberg die Erlaubnis, dort ein „Hüttlein“
zu bauen und weiteren Wald zu roden, um Landwirtschaft zu betreiben.
1607 erwarb das Bürgerspital Auerbach das Gut, das dann im "Dreißigjährigen
Krieg“ (1618-48) allmählich verfiel. 1687 baute die Spitalstiftung den Hof
wieder auf und bewirtschaftete die Felder.
Um 1721 erwarb der Auerbacher Landrichter Freiherr von Blumenthal, der auch
Besitzer von Hammergänlas war, Sackdilling. Sein Nachfolger Johann Georg von
Grafenstein erwarb beides 1757 von der Gant weg. 1844 schließlich verkaufte
Hermann von Grafenstein Sackdilling an den bisherigen Pächter Johann Kugler von
Nitzlbuch. Dessen Sohn Georg wiederum trat das Anwesen 1853 um 8.400 Gulden an
den Staat ab.

Das Forsthaus
Dem Wegmacher Ulrich Gsell vom Sand
(Ortsteil von Nitzlbuch, seit
1978 zur Stadt Auerbach gehörig) war zum 9.11.1859 die neu geschaffene Stelle eines Waldaufsehers mit Wohnsitz Sackdilling übertragen
worden. Die königliche Forstverwaltung ließ wohl auch aus diesem Grund in
dieser Zeit neben den bisherigen Gebäuden eine
Diensthütte errichten; vielleicht war dies zugleich oder zumindest eine Zeit
lang die Wohnung für Gsell, der 20 Jahre bis zu seiner Pensionierung 1879 in
Sackdilling war.
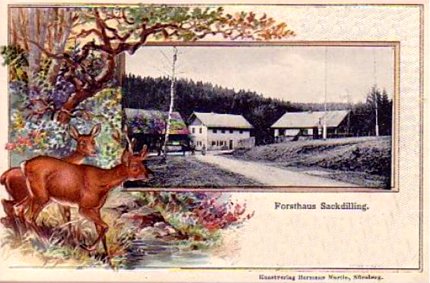
Eine der ersten Ansichtskarten vom Forsthaus
Sackdilling (vor 1900)
(links Stall und Scheune, in der Mitte das Wohn- und Gasthaus,
rechts auf der anderen Straßenseite die Diensthütte des Forsts)
Um 1860 war auch die
Gaststätte eingerichtet worden. Ob Gsell neben seiner Forsttätigkeit zugleich
die Gaststätte betrieb ist nicht sicher; sein Nachfolger in Sackdilling jedenfalls wurde der Rottmeister
Joseph Kipfer.

Im Garten gegenüber dem Wohnhaus steht ein
altes
Marterl. Von der Zeit seiner Entstehung her könnte die Inschrift IK
auf die damalige Betreiberfamilie Kipfer hinweisen.
Warum das Gedenkkreuz davor mit der Aufschrift Ein deutscher Soldat
hier aufgestellt wurde, ist mir nicht bekannt.
Die beiden Tagwerkerhäuser verfielen allmählich und
wurden um die Jahrhundertwende gänzlich abgebrochen. 1911 wurde das übrig gebliebene Gebäude dem
Waldwärter Joseph Kipfer und seiner Familie als Dienstwohnung und Wirtshaus
zugewiesen; ob dies der gleiche wie um 1870 oder vielleicht dessen Abkömmling war, ist
noch zu klären.
Auf Joseph Kipfer folgte Ludwig Frank (1925-49) als Förster und Wirt in Sackdilling.
In seiner Amtszeit war bis
1945 der Wald um Sackdilling ein beliebtes Jagdrevier von Hermann
Göring.
Dieser erwarb 1939 die Burg Veldenstein bei
Neuhaus, wo er mit seinen Eltern schon viele Jahre vorher zeitweise wohnte. Der
Reichsjägermeister ließ den Weg von Neuhaus nach Sackdilling gut ausbauen,
damit er leichter und schneller in dieses Rotwildrevier kommen konnte.
 |
Nach Kriegsende
und kurzer Zwangsinternierung
wohnte die Witwe Emmy
Göring
mit ihrer Tochter Edda
zwei Jahre lang
in der Dienst- und Jagdhütte
gegenüber dem Forst- und Wirtshaus
in Sackdilling. |
Rudolf Renner
(1949-70) war der letzte Förster, der seinen Dienst- und Wohnsitz in
Sackdilling hatte.
Die Forstdienststelle wurde allerdings bereits 1964 nach Auerbach (Obere Bergstraße 7, ab 1978 Siechenstraße 15)
verlegt. Forstamtmann Heinz Eckert versah 1972 bis zur Reform
der bayerischen Staatsforstverwaltung zum 1. Juli 2005 den Dienst des „Sackdillinger
Försters“.
Das Gasthaus
Zur
gleichen Zeit wie das Wirtshaus, also um 1860, entstand auch ein Festplatz
in Sackdilling. Es war ja, wie eingangs schon geschildert, vor allem an den Sonn- und
Feiertagen viel
los dort. Zahlreiche Besucher wussten die idyllische Lage inmitten des
ausgedehnten Waldgebietes von jeher schätzten.
Gastwirte waren bis 1964 die oben genannten jeweiligen Förster.
1964 tauschte Martin Renner, der verstorbene Vater des derzeitigen gleichnamigen Besitzers,
ein Stück Privatwald gegen Sackdilling ein. Er bewahrte dadurch das Gasthaus
vor der Schließung durch den Staat, denn derartige Enklaven waren schon ein
Dorn im Auge der Forstbehörde.

Ab 1975 erfolgte dann ein gründlicher Um-
und Anbau des alten Forst- und Wirtshauses Sackdilling in einen modernen Gastronomiebetrieb, der
wie vor über 100 Jahren, wieder Ziel zahlreicher
Besucher war.
 |
Busausflügler
steuerten Sackdilling gern an,
auch wegen der großen Sonnenterrasse.
Besonders für
Familienfeiern
und größere Gesellschaften
waren die drei ausgedehnten
und gemütlich eingerichteten Gasträume
gut geeignet. |
|
Der unmittelbar neben dem Gasthof
von der Stadt Auerbach
eingerichtete
Kinderspielplatz
wurde von Familien mit Kindern
und natürlich den jungen Gästen
gerne angenommen.
Leider wurde er
ebenfalls aufgegeben.
|
 |

Seit
Frühsommer 2009 ist die beliebte Gaststätte leider geschlossen!
Die früheren Gastronmieräume sind zu Wohnzwecken für die
Eigentümer umgebaut.

Rund* um
Sackdilling lässt sich gut wandern,
z.B. auch im Auerbacher Bürgerwald. Mehrere Höhlen,
wie das Windloch
(Artikel von Keupp/Plachter,
Erlangen 1972) reizen nicht nur die Höhlenforscher.
Das
Felsenlabyrinth
mit dem großen und dem kleinen Bauernloch
ist ebenfalls einen Besuch wert.
*Nur wenige hundert Meter westlich des Wohnhauses beginnt der Truppenübungsplatz
Grafenwöhr. Allerdings findet in diesem Bereich nahezu kein Übungsbetrieb
statt.

"Sackdilling. Eine Oase im grünen Wiesenteppich, umschlungen vom Arm des
Hochwaldes. Hier ist gut sein!"
(5, Seite 459)
verwendete und weiterführende Quellen
| 1 |
Schnelbögl, Fritz, Sackdilling - Ein
Ortsnamenrätsel, Beilage Heimatkurier des Fränkischen Kuriers vom
10.1.1937 |
| 2 |
Köstler, Joseph, Kirchen- und
Schulgeschichte von Auerbach, Band XIX |
| 3 |
Schnelbögl, Fritz, Sackdilling - Ein
Ortsnamenrätsel, in Mitteilungen der Altnürnberger Landschaft (ANL) vom
Juni 1964 |
| 4 |
Schnelbögl, Fritz, Auerbach in der
Oberpfalz, Auerbach 1976 |
| 5 |
Hering, Geo, Gang um Auerbach, in
Oberpfälzisches Heimatbuch, Kallmünz 1950 |
| 6 |
Lang, Stephan, Höhlen in Franken, Nürnberg
2002 |
letzte
Bearbeitung dieses Artikels am 30. Oktober 2024

|
Für Ergänzungen, Korrekturen usw.
bin ich sehr dankbar.
Hier können Sie mich erreichen!
|

|
 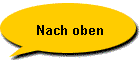 |