|
| |
.jpg)
Zur politischen Gemeinde Degelsdorf
gehörten bis 1978 u.a. Reichenbach (vorne), Degelsdorf (Mitte) und Zogenreuth.
Dazu kamen noch einige Mühlen.
Mehr phantastische Luftbilder des
Drachenfliegers Alois Laumer (Weiden)
finden Sie auf dessen Internetseite
http://www.oberpfalz-luftbild.de/

Die Ortschaft Degelsdorf

Degelsdorf
ist heute ein Ortsteil der Stadt Auerbach
i.d.OPf. und
liegt ca. 2 km nordöstlich von ihr. Nach dem
Stand vom 31.12.1990 lebten in 81 Anwesen 312 Menschen, zum 1.6.2005 waren es
noch 272 Einwohner, zum 1.1.2010 nur mehr 265.
(Foto aus dem Jahr 1957)
Der Name
Degelsdorf ist schwer zu erklären. Vom Tegel oder der Tonerde stammt der
Name nicht; dagegen spricht nicht nur die geologische Formation der Gegend,
sondern auch die dialektische Aussprache des Wortes 'Deigelsdorf'. Ich leite den
Namen her von Deuchel oder Roheisen und glaube, daß Degelsdorf ursprünglich
ein Eisenwerk war, das aber nur kurzen Bestand hatte.“ So versucht Joseph Köstler,
der große Auerbacher Chronist, den Ortsnamen zu erklären. (Band XIX, Seite
144)
Fritz Schnelbögl dagegen meint, dass Degelsdorf eine Verbindung eben von „dorf“
mit einem slawischen oder deutschen Personennamen ist, vielleicht nach dem Begründer
der Ortschaft benannt.
2k.jpg)
|
Zur bis zum 30. April 1978
selbständigen
politischen Gemeinde Degelsdorf
gehörten u. a. die Ortschaften
Reichenbach
und Zogenreuth,
sowie die Neu- und die Speckmühle.
Letzter Bürgermeister von Degelsdorf
war der Schleifmüller
Max Wiesent (+1985),
der dieses Amt über Jahrzehnte ausübte.
An ihn erinnert die Max-Wiesent-Straße.
(Foto
Archiv Gebhardt)
|
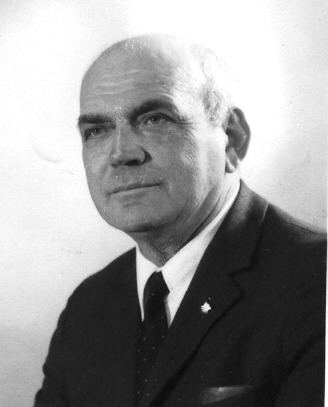 |
Entstehung des Ortes
Als
Auerbach 1144 Markt und selbständige Pfarrei wurde, existierte Degelsdorf wohl
noch nicht. Zu dieser Zeit waren die heutigen Fluren von Degelsdorf, Reichenbach
und die der Mühlen am Speckbach noch gänzlich vom Wald des „Veldener
Forstes“ (etwa ab der Mitte des 14. Jahrhunderts „Veldensteiner Forst“
genannt) bedeckt. Die Forsthube Reisach, einer der insgesamt 18 Forstbezirke
dieses großen zusammenhängenden Waldgebietes, umfasste neben Auerbach auch
Degelsdorf.
(„Hube“ oder „Hufe“ ist ein altes deutsches Maß für
landwirtschaftlichen Grund in einer Größe, die von einer Familie bearbeitet
werden und diese sich von dem Ertrag ernähren konnte.)
Der
Forsthof Reisach selber stand der Überlieferung nach zwischen Pfannmühle und
Burgstallmühle ungefähr dort, wo sich früher der Mühlbach vom Altbach trennte.
Der jeweilige Inhaber dieses Hofes hatte die Forsthube zu betreuen und zu beaufsichtigen.
Die
Entstehungszeit von Degelsdorf dürfte zwischen 1144 und 1300 liegen; ein
genauer Zeitpunkt ließ sich bisher nicht feststellen.
Die Stromer und Degelsdorf
Das
Auerbacher Patriziergeschlecht der Stromer war wohl schon von Anfang an mit der
Ortschaft eng verbunden.
 |
Dr. Heinrich Stromer,
der Gründer des weltbekannten
Lokals
„Auerbach's Keller“ in
Leipzig,
stammt aus
diesem Geschlecht. |
Die
Auerbacher Stromer erwarben vom Bamberger Bischof das Recht, Teile des Waldes der
Forsthube Reisach zu roden und Ortschaften und Mühlen anzulegen. Deshalb
gehörten zunächst alle Höfe von Degelsdorf den Stromer, die sie nach und nach
veräußerten. So kaufte z.B. das Kloster Michelfeld 1378 eine halben Hof zu
Degelsdorf von Eberhard Stromer.
Auch
kirchliche Stiftungen wurden so Besitzer in Degelsdorf. Als Beispiele seien
genannt die Frühmessstiftung bei der Auerbacher Pfarrkirche, die 1425 drei Güter
besaß, und die Pesslermesse, der in dieser Zeit ein Hof gehörte.
Die
Stromer verkauften auch an das Spital in Auerbach, dem nach dem Salbuch von 1560
in Degelsdorf drei Anwesen gehörten.
Jeder
Hof hatte an seinen Besitzer bestimmte Abgaben zu entrichten. Als Beispiel sei
der „Wastl“ (heute Hausnummer 1, Deiml) angeführt, der folgende
Naturalien an das Spital abzuliefern hatte: an Michaeli 8 Viertl Korn (1
baierisches Viertl war 18,5 Liter), an Martini 8 Viertl Hafer, an Pfingsten 4 Käse
und 30 Pfennig Geld, an Fastnacht und im Herbst je eine Henne, an Ostern 2
Schock (=120 Stück) Eier und an Weihnachten 4 Käse. Dazu mussten auch noch 4
Frontage mit Pflug und Mäher geleistet werden.

Unsere
Vorfahren, gerade im ländlichen Raum, waren mit vielen Abgaben belastet, z.B.
Zehnt und Gült (auch Gilt genannt).
Während sich der Zehnt in seiner Höhe nach den jährlichen Erträgnissen an
Feldfrüchten und solchen aus der Viehhaltung richtete, war die Gült eine
Grundlast. Sie bestand in Gelderbzins und allerlei Naturalien und musste in der
im Lehnbrief festgelegten Höhe auch geleistet werden, selbst wenn der Bauer ein
schlechtes Jahr hatte. Jeder Bauernhof, der mit dieser Abgabe belastet war, führte
den Namen "Gülthof" (auch „Gilthof“).

Die Reformationszeit
Auch
der Pfarrer von Velden hatte noch 1560 einen „Gilthof“ in Degelsdorf, den damals
ein Hans Pürner bewirtschaftete. (heute beim „Birner“, Hausnummer 6,
Diertl; Foto ca. 50 Jahre alt).
 |
Immerhin 40
Viertl Getreide musste der Birner
jährlich an den Pfarrhof nach
Velden abliefern,
wobei ein bairisches Viertl 18,5 Liter war.
(Unsere ganze Gegend gehörte bis 1144 zur
Pfarrei Velden.)
|
Degelsdorf
war in diesen Jahren, wie auch Auerbach und nahezu die gesamte Oberpfalz,
evangelisch bzw. lutherisch.
|
Als Kurfürst Maximilian von Bayern
1628
für die dem Kaiser im 30jährigen
Krieg
geleisteten Dienste die Obere Pfalz bekam,
mussten die Bewohner bis zum 1. November desselben Jahres
wieder katholisch
werden.
Manche Untertanen weigerten sich
und mussten das Land verlassen. |
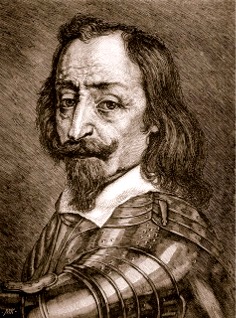 |
Zu den
„hartnäckigsten Lutheranern“ (Köstler, Band XIX, S. 149) gehörten der
Speckmüller Georg Edl, der Pfannmüller Michl Grüner und der Degelsdorfer
Bauer Hans Pürner.
Pürner berief sich darauf, dass seine Grundherrschaft, die Stadt Nürnberg, zu der
Velden inzwischen gehörte, ihm den Übertritt zum katholischen Glauben
streng verboten habe. Der Auerbacher Landrichter schickte ihm deshalb anfangs
Januar 1629 kurzerhand vier Soldaten „zur Bekehrung“ ins Quartier. Ihnen
musste Pürner täglich je 6 Pfund Fleisch und Brot und 12 Maß Bier zur Verköstigung
reichen.
Obwohl
die Erlaubnis zum Religionswechsel von Velden und Nürnberg versagt wurde,
beugte sich Pürner, weil er die große Belastung nicht länger ertragen
konnte, und wurde mit seiner Familie am 29. Januar 1629 katholisch. Wie die
anderen Degelsdorfer Anwesen brannte auch dieser Hof im „Dreißigjährigen
Krieg“ ab. Velden und Nürnberg weigerten sich, die Gebäude wieder aufzubauen.
Das Kloster Michelfeld erwarb schließlich die Brandstätte und stellte den
Hof 1684 wieder her.
Johann Michael Doser
Am 20.
April 1678 kam in Degelsdorf dessen berühmtester Sohn zur Welt, der Bildhauer
und Altarbauer Johann Michael Doser.
„Sein
Vater, Hans Adam Doser, wohl aus dem bayerisch schwäbischen Voralpenland
stammend, war Reiter in der kurbaierischen Kompanie des Hauptmanns Gräf, die
zur Zeit des Holländischen Krieges, 1672-1679, hier im Quartier lag.“ (Rohner/Hamperl,
Die Schnitzwerke Johann Michael Dosers, Seite 4)
Die
Familie zog bald darauf nach Schnaittach, wo Hans Adam Doser eine
Schreinerwerkstatt betrieb.
Nach
Jahren der Ausbildung und der Wanderschaft zog Johann Michael 1710/11 nach
Auerbach. Im Haus „Untere Vorstadt“ 1 unterhielt er seine Werkstatt, aus der
im Laufe seiner Schaffensjahre zahlreiche Kunstwerke hervorgingen. Am
bekanntesten sind wohl seine „Akanthusaltäre“, wie sie z.B. auch in der
Auerbacher Pfarrkirche St. Johannes der Täufer anzutreffen sind.
 |
Den
Werken des umfassenden Schaffens
des Barockkünstlers Johann Michael Doser
begegnen wir in unserer Heimat auf Schritt und Tritt,
hier z.B. die
Florian-Statue an einem Langhauspfeiler
der Pfarrkirche St. Johannes der
Täufer in Auerbach.
Dr. Hamperl und Pater Rohner haben Leben und Werk
in zwei Büchern
ausführlich und reichbebildert beschrieben.
Beide Bücher sind im Verlag
Schnell & Steiner erschienen
und heißen „Böhmisch-Oberpfälzische
Akanthusaltäre“
und „Die Schnitzwerke Johann Michael Dosers“.
In Degelsdorf, dem Geburtsort des Künstlers,
ist bisher leider noch
keines seiner Werke aufgetaucht,
und so erinnert hier nur der Name einer Straße
an den berühmtesten Sohn des Orts. |
„Geboren
am 20. April 1678 in Degelsdorf, gestorben am 13. November 1756 in
Auerbach", lauten seine schlichten Lebensdaten.
Alte Waldrechte
Die
Bauern von Degelsdorf durften schon in sehr früher Zeit ihr Brennholz aus dem
kurfürstlichen Forst holen, mussten dafür aber je nach Größe des Hofes jährlich
den „Forstgulden“ bezahlen.
Anno
1579 lebten folgende „Forstrechtler“ im Ort (die Höhe der Abgabe in
Klammern; fl bedeutet Gulden): Hans Pürner (1/2 fl), Hans Stümpfl (1/2 fl),
Hans Rüppl (1/2 fl), Conz Wiesent (1/2 fl), Fritz Stümpfl (1/2 fl), Hans Rüppl
sen. (1 fl), Mathes Fronhöfer (1 fl) und Hans Rüppl der Mittlere (1 fl). Der
Hirt Hans Engelthaler und der Schäfer Hans Ehemann hatten kein Holzrecht.
Das
gleiche Holzrecht wie die Degelsdorfer hatten übrigens auch die „Bürgerbauern“
in Schleichershof, Reichenbach, Dornbach, Pinzig und Bernreuth.
1683
wurde den „Rechtlern“ der Holzbezug gekündigt, weil sie seit mindestens
40 Jahren ihren „Holzgulden“ nicht mehr bezahlt hatten und auch nicht weiter
zu zahlen gewillt waren. 1726 schließlich wurde das Holzrecht für erloschen
erklärt, und die Bauern bekamen ihr Holz nur mehr gegen Bezahlung des üblichen
Preises. Allerdings war jener in dieser Zeit nicht hoch, denn noch um 1790 kosteten
ein Klafter Holz (1 bayer. Klafter waren 3,13 Kubikmeter) nur etwa 36, ein Fuder
Streu gar nur 12 Kreuzer.
Zur
selben Zeit etwa musste man für ein Pfund Schweinefleisch immerhin 5,5 und für
eine Maß Bier 2 Kreuzer hinlegen. Ein Tagwerker erhielt pro Tag 7 Kr und freie
Kost oder 14 Kr ohne Essen, ein guter Mauerer oder Zimmerer verlangte für einen
Tag 21 Kr Lohn, ein Bauer mit zwei Rössern erhielt sogar einen Gulden und zusätzlich
12 Kreuzer für Essen und Trinken.
Degelsdorfer
Hausnamen
In
alter Zeit hatte jedes Anwesen seinen Hausnamen, Familiennamen oder gar
Hausnummern kamen erst viel später in Gebrauch.
Auch in
Degelsdorf trugen die Höfe seit alters Hausnamen, die sich allerdings im Laufe
der Jahrhunderte verschiedentlich änderten. Leider stimmen auch nicht mehr alle
heutigen Hausnummern mit den früheren überein.
 |
Hausnummer
1 heißt heute noch „beim Wastl“.
Seit dieses Anwesen 1681 Sebastian
(mundartlich Wastl) Deiml
erwarb, ist es im Besitz dieser Familie.
Dieses alte Foto zeigt den Bauern Xaver Deiml
mit Frau (Mitte) und einige andere
Personen. |
Der
alte Hof Nummer 2 hieß früher nach seinem Besitzer von 1616 „beim Stümpfl“.
Im Laufe der Jahrhunderte wurde dieses Anwesen mehrmals "vergantet"
(d.i. versteigert) und wechselte deshalb häufig den Besitzer. So gehörte es u.
a. gegen Ende des vorigen Jahrhunderts verschiedenen jüdischen Händlern aus
dem Raume Nürnberg.
Nummer
3 hieß früher Lehnerhof oder Lehnergütl und war etwa 1670 bis 1850 mit dem Rüpplhof
Nr. 7 verbunden. Da dieses Anwesen von einem Tagwerker bewohnt wurde, erhielt
es den Hausnamen „beim Dowerker“.

Degelsdorfer Jungmänner beim Singen und Musizieren
(Foto Archiv Gebhardt, etwa 1940)
Die
Anwesen Nr. 4, der „Wöhrlhof“, und Nr. 5, das „Schleiferhöfl“,
bildeten noch bis nach dem Dreißigjährigen
Krieg 1681 einen einzigen Hof, der zum Spital in Auerbach gehörte. In jenem
Jahr baute die Spitalverwaltung das 1634 eingeäscherte Anwesen neu auf und
teilte es. Der Besitzer von Nummer 4 hieß Ulrich Würl, was diesen Hausnamen
erklärt. Die andere Hälfte gehörte einem Hans Schuster, so dass der alte
Hausname von Nr. 5, „Schleiferhöfl“, anderen Ursprungs sein muss. 1893
erwarb Johann Fuchs dieses Anwesen und vererbte es an seinen Sohn Sebastian, den
„Fuchsn Wastl“.
„Beim
Fuhrhansn“ hieß das Anwesen 6 früher. Es gehörte ursprünglich zur
Schlosskapelle in Hartenstein und seit etwa 1507 zur Pfarrei Velden, wohin auch
jährlich 40 Viertl Getreide abgeliefert werden mussten. Bei der
Gegenreformation kam es zu dem schon geschilderten Konflikt des Hans Pürner.
Dieser Name taucht erstmals 1560 in der Besitzerliste auf und erklärt sicher
den noch heute gebräuchlichen Hausnamen „beim Birner“.
 |
Über
den „Rüpplhof“ (Nr. 7) heißt es,
dass es zwar nicht das größte Anwesen
des Dorfes war,
wohl aber das angesehenste. Seine Besitzer
bekleideten
meistens das Amt des „Ortsführers“,
des „Dorfhauptmanns“ oder des
Bürgermeisters;
auch der letzte stellv. Bürgermeister Franz Schindler stammt
von hier.
Dieses Anwesen war als eines der ganz wenigen
„freies Eigentum“
und damit praktisch zehentfrei.
Seinen Hausnamen hat es wohl von
seinem
1616 bekannten Besitzer Georg Rüppl.
Zum Rüpplhof gehört dieses alte Marterl,
das nach einem Unglück
errichtet worden sein soll. |
|
Beim Rüppl stand bis vor wenigen Jahren
das "Milchbänkl", auf dem sich diese
Degelsdorfer Jungmänner
fotografieren ließen. |
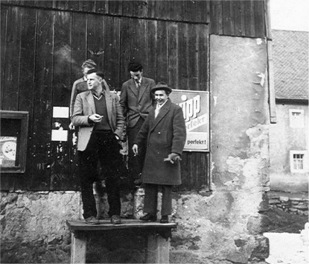 |
„Beim
Hirmer“ (Nr. 8) kommt wahrscheinlich von einem Besitzer namens Hermann. Der
Hof musste ans Kloster Michelfeld seine jährlichen Abgaben entrichten. Der
erste namentlich feststellbare Besitzer war 1796 Anton Trenz. Sicher ist der Hof
aber viel älter.
 |
Hausnummer 9 "beim Hansl"
(früher „beim Ströll“ oder auch „beim
viedern Stümpfl“ genannt)
war
ebenfalls ein sog. Bamberger Mannslehen
und deshalb auch dem Kloster
Michelfeld abgabepflichtig. |
Bei jedem Besitzerwechsel, also auch bei der Hofübergabe
an den Sohn z.B., musste an die Grundherrschaft 10 Prozent des Wertes als Handlohn abgeführt werden.
 |
Sicher einer der ersten "Bulldoggs"
im Dorf,
den hier junge Degelsdorfer stolz präsentieren. |
„Das
Mühlarztgütl“ (Nr. 10) existiert in dieser Form heute nicht mehr. Es war früher
ein „unbezimmerter Hof“, also nicht bewohnbar, und gehörte dem Schleifmüller.
Erst 1837 errichtete Michael Grüner ein kleines Haus auf diesem Anwesen. 1874
erwarb es Magdalena Kugler und vereinigte es mit ihrem väterlichen Anwesen
Nr. 9.
„Der
Knieerhof“ (Nr. 11) musste noch 1770 seine Gilt an die Pfarrei Velden geben,
wurde 1812 aber freies Eigentum mit 65 Tagwerk Grund. Nach Georg Knieer, 1680
bis 1721 Besitzer, erhielt das Anwesen seinen Hausnamen. 1790 erwarb es der
Schleifmüller Leonhard Grüner und vererbte es an seinen Sohn Jakob.
|
Nummer
12 war das alte Hirthaus.
Es war ein kleines Häusl und wurde nicht nur
vom jeweiligen
Dorfhirten mit seiner
Familie bewohnt,
sondern diente der Gemeinde
zugleich auch als Armenhaus.
Der jetzige Eigentümer des Anwesen,
Richard Ziegler (1932-2019)
baute mit seiner
Familie
das Hirthaus an und auf,
so dass dieses stattliche Gebäude
entstand.
Es gehört heute seinem Sohn Peter
mit Familie. |
 |
 |
alte Ansicht des Hauses Nummer 16 |
Zu
den relativ wenigen Anwesen des alten Ortskerns Degelsdorf, die
praktisch alle entlang der fast parallel zum Speckbach verlaufenden Hauptstraße
liegen, kamen in den letzten Jahrzehnten eine ganze Reihe von Neubauten vor
allem am nordwestlich davon liegenden Hang, z.B. am Spitlberg und zum Pinzigberg
hin.

Zuletzt wurden auch an der Hauptstraße, der
Johann-Michael-Doser-Straße, auf der Bachseite mehrere schmucke Eigenheime
errichtet.
Aus dem einst nahezu rein landwirtschaftlich geprägten Dorf Degelsdorf ist
mittlerweile eine Ortschaft geworden, in der nur noch ganz wenige Bauernanwesen
bewirtschaftet werden.
|
 |
Feiern - das Foto in der Gaststätte Pleier
ist schon ein paar Jahrzehnte älter -
tun die Degelsdorfer auch heute
noch gern.
Im 1984 in der Nähe der ehemaligen Pfannmühle
erbauten Schützenheim und
auf dem Platz davor
sind z.B. das Johannisfeuer und die Kirwa
wieder zu
einem richtigen Dorffest geworden.
Das nicht dauernd offene Heim
des Schützenvereins
Eichenlaub
und der Landgasthof
zur Leonie
-
Wirtshaus und Boutique Hotel -
sind die Einkehrmöglichkeiten
in Degelsdorf.
Sehenswert sind die Auerochsen
im NSG Grubenfelder Leonie,
der Mühlenweg, und die nahe
Kapelle auf dem Pinzigberg |
Straßennamen für
Degelsdorf
Durch die zahlreichen Neubauten waren im Laufe der
Jahrzehnte viele neue, ungeordnet über das Ortsgebiet verstreute Hausnummern
gekommen; für Fremde oder auch den Notarzt war ein Zurechtfinden
schwierig geworden.
Zum 1. Juli 1993 wurden in der Bundesrepublik Deutschland neue, fünfstellige Postleitzahlen
eingeführt. Adressendruck, Stempel usw. mussten dadurch neu angefertigt werden
und so entschloss man sich, auch in Degelsdorf Straßennamen einzuführen. Die
dafür zuständige Stadt Auerbach überließ die Namensauswahl ganz den
Degelsdorfern. So zog der damalige Stadtrat Hans Lederer aus dem Degelsdorfer
Ortsteil Zogenreuth praktisch von Straße zu Straße und von Haus zu Haus und
erkundete die Wünsche der Anwohner. Heraus kamen u. a. Straßennamen, die z.B.
an alte Flurbezeichnungen, ehemalige Mühlanwesen oder verdiente Personen
erinnern:
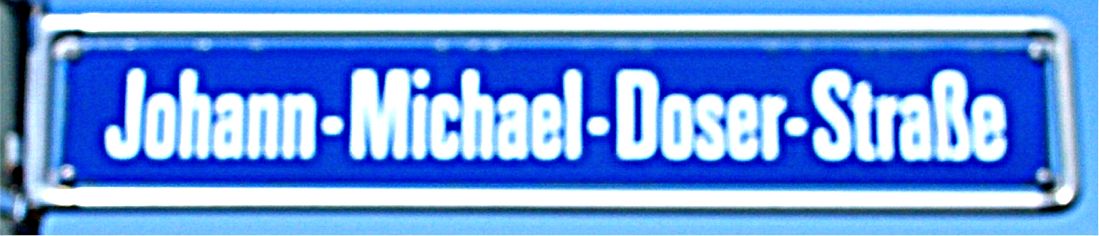
Mühlen am Speckbach
Am noch
jungen Speckbach vor und hinter Degelsdorf lagen seit alter Zeit mehrere Mühlen:
die Rohrmühle, die Schleifmühle,
die Pfannmühle, die Burgstallmühle,
die
Neumühle und die Speckmühle. Diese uralten Anwesen gehörten bis 1978 ebenso zur politischen
Gemeinde Degelsdorf wie Zogenreuth, Reichenbach
und der Schleichershof.
Über den Mühlenweg kann man u. a. die Mühlen am
Speckbach erwandern.

 |
Melodie: Sah ein Knab´ ein Röslein
steh´n |
letzte
Bearbeitung dieses Artikels am 24. März 2025

|
Für Ergänzungen, Korrekturen usw.
bin ich sehr dankbar.
Hier können Sie mich erreichen!
|

|
 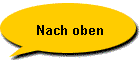
|