|
| |
Portenreuth
Zusammen mit Ober-, Unter- und
Schloßfrankenohe, sowie Kotzmanns und Meilendorf bildete Portenreuth die
politische Gemeinde Oberfrankenohe.

Die Ortschaft Portenreuth von Westen her gesehen. Vorne der
große Dorfweiher, den vor allem die jüngeren Bewohnern im Sommer zum Baden und
im Winter zum Eislaufen nutzten. (1, Seite 218)
1fkk.jpg)
„Das
Dorf Portenreuth befand sich knapp 2 km südostwärts Ernstfeld nördlich der
Bezirksstraße Eschenbach-Hopfenohe-Auerbach rund 700 m ostwärts der alten
Reichsstraße nach Bayreuth. Es lag sehr reizvoll am Hang oberhalb des
Dorfweihers, in dem sich abends die untergehende Sonne spiegelte.“ (1, Seite
217)
Heute erinnert nur mehr die Bezeichnung "Wüstung Portenreuth" auf der
Karte des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr daran, dass im Gebiet der
Panzerschießbahn 301 früher diese uralte Ortschaft lag.
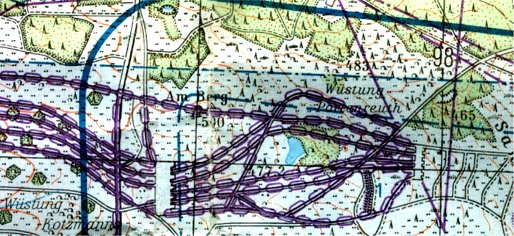
Die Anfänge von
Portenreuth
Der
Ortsname lässt den Schluss zu, dass Portenreuth eine fränkische Siedlung aus
dem 8. bis 10. Jahrhundert ist bzw. war. Bekanntlich
zeigen Orte mit der Endsilbe "-reuth" an, dass zur Besiedelung zunächst der
Wald ausgereutet, also gerodet werden musste. Bei diesen Ortsnamen weist
meistens die vordere Silbe auf den ersten Kolonisten, den Vorarbeiter bei den
Rodungsarbeiten, der durchaus auch ein Slawe sein konnte, oder eben den Gründer
der Ansiedlung hin; als Beispiele unserer Gegend seien Zogenreuth
(Zudo oder Zugo), Troschenreuth (Drogo oder Drosco) und Bernreuth
(Beringar oder Bernger)
genannt. So wird es bei Portenreuth wohl ein Porto oder Borto gewesen sein, nach
dem das Dorf benannt wurde.
"Im Jahre 1335 stand
der Zehnt des ganzen Dorfes dem Pfarrvikar in Hopfenohe des Klosters Michelfeld
zu. Später ging der Zehentanspruch an die Pfarrei Hopfenohe über." (1,
Seite Seite 217)
Familie
Kotz
Portenreuth
bestand ursprünglich und für Jahrhunderte nur aus drei
bäuerlichen Anwesen. Diese gelangten im Jahre 1550 durch Hans Kotz in den Besitz dieser Familie, die schon seit 1450
im nahen Metzenhof
saß. Ein Hans Kotz besaß bereits 1422 "die Hammermühle und die
Glashütte oberhalb Neuhaus an der Pegnitz als Bamberger Lehen." (3, Seite
162) Den Kotz gehörte darüber hinaus Kumpf und seit 1555 auch der Hammer
Hellziechen.
|
Das uralte Hammergut
Hellziechen
lag etwa 6 km nördlich von Vilseck.
Es "wird erstmals urkundlich erwähnt
in einer Belehnungsurkunde von 1402
des Bischofs Albrecht von Bamberg
an Heinrich Kratzer, Bürger von Vilseck.
1444 wird in den Akten der Hammer
„Heltzeichen“ zum Amt Vilseck geführt."
(1, Seite 35; Foto Hammerschloss
mit übers Eck gestelltem
Renaissanceerker, Seite 177) |
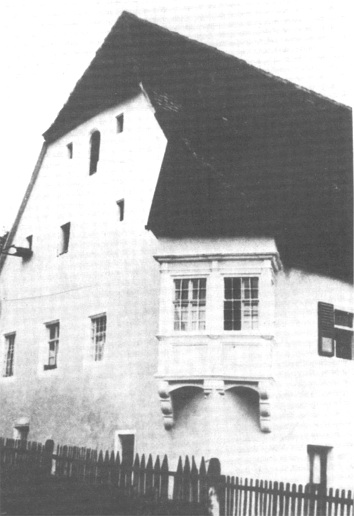 |
Im
Jahre 1575 starb Hans Kotz von Metzenhof. Erben wurden seine beiden Neffen Hans
Christoph und Hans Jakob Leonhardt, die Söhne seines Bruders Sigmund. Beide einigten sich bezüglich des Erbes dahin, dass Hans Jakob Leonhardt
Portenreuth - auf ihm saß sein Vater bisher ja schon als Miteigentümer - und
Hans Christoph den ganzen Metzenhof als Alleineigentum übernahm.
"Christoph Kotz von Metzenhof bildete 1581 aus den drei Höfen des Dorfes
Portenreuth ein Landsassen- oder Rittergut und baute sich dort seinen Sitz. Am
17. August 1581 erhielt er Adelsbrief und Wappenschild." (1, Seite 217)
Die
Kotz´sche Familie war durch die Eisenindustrie sehr wohlhabend geworden und weit verzweigt.
Auch in Auerbach spielt sie eine Rolle. "Johannes (Hans) Leonhard wurde am
25. Januar 1593 zu Auerbach als Sohn des Kastners
Wolfgang (Wolf) Kotz geboren. ... Vater Wolfgang war 1590-1602 landesherrlicher
Kastner in Auerbach, war bis zu seinem Tod Ratsbürger und zeitweiliger Bürgermeister.
Die Familie, zu der auch der Auerbacher Forstmeister Hans Thomas Kotz (+1616)
und der Hammerverwalter zu Ranna Johann Erasmus
gehörten, war aus dem Hammergut Metzenhof östlich Kirchenthumbach gekommen.
Wolfs Vater, Hans Leonhards Großvater, arbeitete dort als Hammermeister."
(3, Seite 162)
Von 1609 bis 1618 sitzt Hans Sigmund von Kotz in Portenreuth.
Im nun folgenden 30jährigen Krieg wurde Portenreuth von Truppen
schwer verwüstet. Neben den Soldatenhorden verheerten noch zusätzlich Viehseuchen und Brände
das Dorf. Dies hatte zur Folge, dass die Bauern verarmten. Viele von ihnen starben
auch an der Pest oder erlitten den
Hungertod.
Die Kotz sind noch bis 1720
Besitzer von Portenreuth; ihr letzter Vertreter war 1696 bis
1720 Emanuel Christoph von Kotz.
Die
von Schreyer-Blumenthal
"1720
kam Portenreuth in den Besitz des Johann Anton von Schreyer-Blumenthal. Die
Schreyer waren seit 1372 berühmte Eisenfabrikanten, die eine Menge Hammergüter
besaßen, darunter auch Trevesen, Gronau, Grünberg, Gänlas
und Bodenwöhr. Geadelt wurden die Schreyer erst 1591. Als Wappen hatten die
Schreyer-Blumenthal eine Mauer mit 3 Zinnen im Schild, auf deren mittleren Zinne
ein zweiköpfiger Adler steht. Auf dem Wappenhelm stand ebenfalls der
Doppeladler.
Anno 1721 am 30. Oktober beschreibt Johann Anton Lorenz von Schreyer die Häuser
und Untertanen seines Landsassengutes Portenreuth folgendermaßen:
 |
1. das Schloß, dessen Eigentümer ich bin. Meine Untertanen
sind: |
 |
2. Hans Georg Schwindl, ¼ Hof |
 |
3. Hans Schwindl, ¼ Hof |
 |
4. Georg Raß, 1/8 Hof |
 |
5. Hans Georg Kroher, 1/8 Hof |
 |
6. das Hirthaus(2,
Seite 292)
|
Letzter
Spross der Familie ist Sebastian, der 1782 starb. Mit seiner Witwe Eva endete 1786 die Hofmarksherrschaft derer von
Schreyer-Blumenthal in Portenreuth.
Die
von Schenkl auf Portenreuth
1786
erwarb der Regierungsdirektor bei der Finanzkammer Amberg Franz Anton von Schenkl
Amberg das Landsassengut Portenreuth. Er war ein Enkel des Auerbacher
Stadtschreibers Johann Mathias Schenkl. Der Vater
des Franz Anton, Johann Samuel Martin Schenkl, hatte 1767 von den Söhnen des
verstorbenen Ludwig Georg Christoph von Schlammersdorff das Landsassengut
Hopfenohe erworben und damit eine der Voraussetzungen für das Führen
eines "von" vor dem Namen erworben. Mit
der Verleihung des Adelstitels 1787 war für von Schenkl auch das Recht
verbunden, ein eigenes Wappen zu führen.
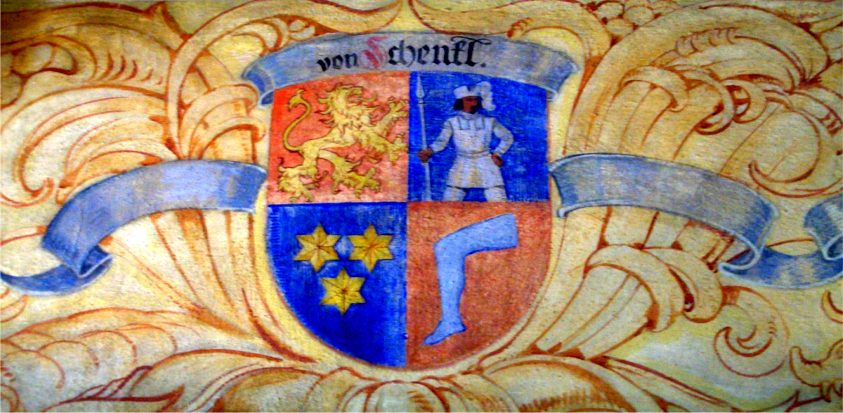 |
Der geharnischte Schenkl
weist auf den Namen hin.
Dieses Wappen ist so
im Sitzungssaal
des Auerbacher Rathauses
angebracht. |
Nach
dem Tode des Franz Anton von Schenkl 1808 erbte der einzige Sohn Joseph die
Landsassengüter Hopfenohe und Portenreuth und den Besitz in Auerbach. Der
besseren Verwaltung halber wollte er die beiden Güter zusammenlegen. "Am 21. Januar 1817 genehmigte die Regierung die Errichtung
dieses gemeinschaftlichen Patrimonialgerichts, welches 15 Familien in Hopfenohe
und 8 Familien in Portenreuth umfaßte. ... Als 1825 der Regierungsrat Joseph
von Schenkl starb, wurden auch die beiden Landsassiate und das
Patrimonialgericht Portenreuth begraben. Die Erben verkauften die
Jurisdiktionsrechte an den Staat und den großen Grundbesitz 1831 an die Bauern." (2, Seite 293)
Die einzelnen Anwesen
in Portenreuth

 |
1 Rupprecht Josef und Theresia, beim
„Schlossbauern“ |
 |
2 Schmidt Johann, beim „Schwarz“ |
 |
3 Zeilmann Georg und Margarete, Schneiderei, beim
„Schneider“ |
 |
4 Biersack Johann, beim „Weber“ |
 |
5 Biersack Jakob und Katharina, beim „Schwindl“ |
 |
6 Rupprecht Anna, beim „Kroher“ |
 |
7 Paulus Josef und Josefa, beim „Raß“ |
 |
8 Gemeinde, das Hirthaus (Schmidt) |
 |
9 Trummer Josef und Elisabeth, beim „Gober“ |
 |
10 Dötsch Josef und Anna, beim „Schuster“
|
 |
"Bemerkenswert
war das ehemalige Schloß
Portenreuth,
ein einfacher Langbau
mit Walmach
aus dem 18. Jahrhundert,
ehedem ein Landsassengut.
Es war die typische Anlage eines Landschlößchens
der nördlichen Oberpfalz."
(1, Seite 218)
|
Das Ende von Portenreuth
Georg Rupprecht erwarb 1832 das Anwesen Nr. 1 "beim Schlossbauer" mit
117 Tagwerk Grund.
 |
Johann Rupprecht
stand 27 Jahre als
Bürgermeister
an der Spitze
seiner Heimatgemeinde.
Er wurde deshalb 1925
Ehrenbürgermeister
von Oberfrankenohe,
zu dem auch
Portenreuth politisch
gehörte. |
Sein Nachkomme Joseph Rupprecht wurde am 23. Juni 1938 im
Zuge der Erweiterung des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr abgelöst und zog mit
seiner Familie wenige Monate danach nach Paring bei Rottenburg an der Laaber.
Johann Schmidt von Nr. 2 siedelte sich mit seiner Familie in Pettling bei
Ingolstadt an, die Zeilmann von Nr. 3 zogen nach Auerbach. Familie Johann
Biersack (Nr. 4) ließ sich in Gunzendorf bei Auerbach nieder, Familie Jakob
Biersack (Nr. 5) in Altdorf bei Nürnberg. Anna Rupprecht (Nr. 6) zog mit ihren
Kindern nach Amtmannsdorf bei Beilngries, Familie Paulus (Nr. 7) nach Etzenbach
bei Neufahrn, Familie Trummer (Nr. 9) nach Eschenbach und Familie Dötsch (Nr.
10) nach Kaimling bei Vohenstrauß. (nach 2, Seite 299-304)
Heute erinnert wie oben
schon gesagt nur noch der Karteneintrag "Wüstung Portenreuth"
an das Dörflein.
verwendete Literatur:
| 1 |
Griesbach, Eckehart, Truppenübungsplatz
Grafenwöhr, Geschichte einer Landschaft, Behringersdorf 1985 |
| 2 |
Kugler, Hans-Jürgen, Hopfenohe – Geschichte einer
Pfarrgemeinde, Auerbach 1997; auch als CD erhältlich |
| 3 |
Schnelbögl,
Fritz, Auerbach in der Oberpfalz, Stadt Auerbach 1976
|
| 4 |
Morgenstern, Gerald, Truppenübungsplatz
Grafenwöhr, gestern - heute, Grafenwöhr 2010 (Bezugsquelle) |

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 25. März
2012

|
Für Ergänzungen, Korrekturen usw.
bin ich sehr dankbar.
Hier können Sie mich erreichen!
|

|
 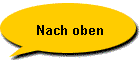
|