|
| |
 |
Kirche
St. Leonhard
Michelfeld |
Spricht man heute von „der
Michelfelder Kirche“, so meint man damit meistens die „Asam-Kirche“, also
die ehemalige Kloster- und heutige Pfarrkirche St. Johannes Evangelista.
St. Leonhard, von 1121 bis zur Säkularisation 1803 Pfarrkirche, wird jetzt als Friedhofskirche
genutzt und hat ebenfalls eine große Vergangenheit; sie ist ein
echtes Schmuckstück unserer ganzen Gegend. Die erste Leonhardskirche
Wohl schon vor dem Jahre 1119, als der hl. Otto
in
Michelfeld das Benediktinerkloster errichtete,
gab es im Ort bereits eine dem hl. Leonhard geweihte Kapelle. 1121 jedenfalls erhob
Otto Michelfeld zur selbständigen Pfarrei,
als er auf dem Rückweg vom Regensburger Fürstentag in seinem jungen Kloster Station
machte. Dabei übergab er mit Urkunde vom 6. November, dem Festtag des hl.
Leonhard, die diesem geweihte Kirche dem Kloster; St. Leonhard wurde dadurch die erste
Michelfelder Pfarrkirche und blieb es fast 700 Jahre lang.
Pfarrei und Pfarrkirche waren dem Kloster
inkorporiert, d.h., der Abt durfte den Pfarrer vorschlagen und auch sonst war
die Pfarrei mehr oder weniger ins Kloster integriert. Ähnlich wie in Auerbach
wird auch in Michelfeld diese erste Pfarrkirche aus Holz gewesen sein. Wann der
erste Steinbau errichtet wurde ist nicht bekannt.
Der Kirchenpatron St. Leonhard
"Der hl.
Leonhard, unser Kirchenpatron der früheren Michelfelder
Pfarrkirche, lebte in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts in Frankreich. Er
starb am 6. November 559 als Abt seines Klosters, das heute St. Leonhard de
Noblat bei Limoge heißt.
Als Vertrauter des französischen Königs begleitete er diesen auf seinen Reisen
durch das Königreich. Er hatte dabei den Auftrag, die Rechtmäßigkeit der
Verurteilung von Gefangenen zu überprüfen. Viele Gefangene kamen durch seinen
Einspruch frei und so wurde Leonhard rasch zum Volksheiligen. Er wurde der
Patron der Gefangenenbefreiung, der sogenannte ´bantlöser´."
 |
Der heilige Leonhard
(links Statue um 1500, rechts Fenster Basel)
wird meistens
als Bischof oder Abt
mit einer Kette in der
Hand dargestellt.
Weltweit
gibt es zahlreiche
dem hl. Leonhard geweihte
Kirchen und noch mehr Kapellen. |
 |
"In dieser
Eigenschaft wurde er besonders von den Rittern und Kreuzfahrern verehrt,
insbesondere dann, wenn diese in islamische Gefangenschaft geraten waren. Aus
dieser Kreuzfahrerzeit stammt auch die plötzliche Verbreitung seiner Verehrung
über Frankreich hinaus nach England, Italien und Deutschland. In Schwaben,
Bayern und Österreich wurde Leonhard zu einem der volkstümlichsten Heiligen,
dem zahlreiche Kirchen geweiht wurden. 1109 wurde die erste Leonhardskirche in
Deutschland geweiht, in Brösch bei Straßburg. Es ist erstaunlich, daß der hl.
Otto schon 1121 und zwar am Festtag des Heiligen, am 6. November, in Michelfeld
die Pfarrkirche St. Leonhard weihte und Michelfeld zur Pfarrei erhob. Otto hatte
also seine Hand am Puls der Zeit.
Am Anfang des 15. Jahrhunderts trat ein Wechsel im Patronat Leonhards ein. Als
Gefangenenbefreier wurde Leonhard mit Ketten und Handschellen dargestellt und
dies besonders im hohen Mittelalter. Als die Kreuzzüge längst vorbei waren,
verstand man die ursprüngliche Bedeutung der Ketten nicht mehr. ´Die
Gefangenkette wurde zur Viehkette umgedeutet.´ So wurde Leonhard schließlich
zum Schutzherrn aller Bauernanliegen wie Vieh, Wetter, Pferde. An sein Fest und
seine Verehrung knüpfen sich eine Reihe von Volksbräuchen: Leonhardsfahrten
und Leonhardsritte mit Pferdesegnung, Darbringung von eisernen Tierfiguren als
Votivgaben, Umspannen von Kirchen mit Ketten, sog. Kettenkirchen. Bisher war
unbekannt und in Vergessenheit geraten, daß solche Frömmigkeitsformen des
Volkes in der Verehrung des hl. Leonhard auch in Michelfeld beheimatet waren.
Die bei der Renovierung gefundenen Eisenopfer beweisen dies.
St. Leonhard ist der einzige Heilige, dem man Eisen opferte. Eisen war ein sehr
wertvolles Metall. Es wurde zu Votivgaben verarbeitet wie z.B. menschliche
Figuren, Körperteile, Tierfiguren, Ringe oder Ketten. In frühester Zeit war
die Gefangenkette am verbreitetsten. Sie wurden zu Hunderten in den St.
Leonhardskirchen aufgehängt.
Zu den Frühformen der Eisenopfer gehören die menschlichen Gestalten. In
Michelfeld selbst wurden drei gefunden. Ebenfalls sehr früh sind die aus einem
Stück geschmiedeten Weihegaben oder die aus einem Flacheisen hergestellten
Eisenopfer. Auch solche Stücke sind beim Michelfelder Fund. Alle Stücke, die
man gefunden hat, scheinen einer sehr frühen Zeit anzugehören. In einer späteren
Entwicklungsform werden die Tierkörper aus einem Vierkanteisen geschmiedet,
Beine und Gehörn werden aus selbständigen Stücken gearbeitet. Es gab mehrere
Orte, in denen die Verehrung des hl. Leonhard besonders blühte und ein eigener
schmiedetechnischer Stil entwickelt wurde, der besonders im 17. und 18.
Jahrhundert zur höchsten Blüte gelangte. Zwei große Gebiete der Verbreitung
der Leonhardsverehrung findet man, einmal den schwäbisch-bayerischen Raum, dann
die Gegenden Kärnten und Steiermark. Eine dritte Gruppe bilden die Fundorte im
Bayerischen Wald (Wiltig, Hetzenbach und Sackenried)."
(1, Das vorstehende Kapitel ist mit freundlicher Genehmigung des Verfassers
Johannes Lindner dem Festbuch „875 Jahre Pfarrei Michelfeld, 1121-1996",
Seite 24 f, entnommen.)
Reformationszeit und 30jähriger Krieg
Als um 1550 die Reformation in Michelfeld Einzug hielt, bekam die Pfarrei
einen lutherischen Pfarrer, nämlich Wilhelm Oberndorfer, einen ehemaligen
Benediktinerpater. Für das Kloster selbst kam das vorläufige Aus mit dem Tode
des Abtes Friedrich von Aufseß am 3. März 1558, denn es durfte weder ein
Nachfolger gewählt noch neue Novizen aufgenommen werden. In den nächsten
Jahrzehnten mussten die Michelfelder mehrmals ihren Glauben wechseln, denn im
sog. Augsburger Religionsfrieden von 1555 wurde u.a. festgelegt, dass der
jeweilige Landesherr das Bekenntnis seiner Untertanen (cuius regio, eius religio)
bestimmen konnte. So wurde z.B. 1559 Friedrich III. Kurfürst der Pfalz. Er war
ein geradezu fanatischer Anhänger des Schweizer Reformators Johann Calvin
(1509-1564) und wollte im Fürstentum der Obern Pfalz den Kalvinismus einführen.
Deshalb ordnete er an, dass alles, was an „das unchristliche Papsttum“
erinnere, wie Tabernakel, Ölberge, Bilder, Messgewänder, Heiligenfiguren usw.
aus den Kirchen entfernt werden sollte. Auch in St. Leonhard wütete der
„Bildersturm“ und vernichtete liebgewordene kirchliche Gegenstände. Eine
Tafel mit dem Wappen des Kurfürsten an der ehemaligen Klosterbäckerei erinnert
an dieses schwere, unselige Zeit.
Wie andernorts wütete der 30jährige
Krieg (1618-48) auch in Michelfeld. Die
Leonharskirche wurde 1634 durch die Schweden niedergebrannt und praktisch zerstört;
auch die Nebenkapelle St. Michael war stark in Mitleidenschaft gezogen worden.
Natürlich hatte auch die Klosteranlage in den Kriegsjahren schwer gelitten. In
den folgenden Jahren wurde die St. Michaelskapelle auf dem Friedhof wieder
soweit hergerichtet, dass dort wenigstens weiterhin Gottesdienste gefeiert
werden konnten, wenn auch unter denkbar widrigen Umständen. Als 1661
Benediktinermönche aus Oberalteich nach Michelfeld zurückkamen und 8 Jahres später
auch formell das Kloster wieder erhielten, begannen sie mit dem Wiederaufbau der
alten und teilweise zerstörten Gebäude. Im Jahre 1700 waren die Arbeiten
weitgehend abgeschlossen und die Abtei Michelfeld war wiedererstanden. Abt
Albert Stöckel (1695-1706) schloss am 4. Mai 1700 mit dem Hochstift Bamberg
einen Vertrag, der u.a. in Punkt 7 besagte: „seint die Kürchen S. Leonhardi
... wieder aufzupauen.“ Pfarrer sollte fortan ein Mönch sein.
Doch erst 1725, nachdem die Klosterkirche praktisch fertig war, kam die
Pfarrkirche St. Leonhard an die Reihe. Unter Pater Otto Holzner, 1722-31 Pfarrer
in Michelfeld, und seinem Nachfolger P. Quirin Öllhardt (1731-41) kam der
Wiederaufbau rasch voran. 1732 konnte die Pfarrei von der sicher zu kleinen St.
Michaels-Kapelle wieder nach St. Leonhard umziehen, allerdings war das
Kircheninnere zu diesem Zeitpunkt noch kahl und ziemlich leer. Die Sakristei war
zunächst im Erdgeschoss des Turmes, denn erst 1741 erfolgte deren Neubau samt
dem Gang zur Kanzel und dem Aufgang zur Orgel.
Die Inneneinrichtung
Leonhard Rau, Schreiner aus dem Ort, fertigte schon anno 1732 die
schlichten Kirchenbänke, Schreiner Lucas aus Auerbach 1741 eine neue Kanzel,
die der berühmte Bildhauer Johann Michael Doser aus Auerbach im gleichen Jahr künstlerisch
ausgestaltete.
Der zunächst wohl sehr einfache und vielleicht nur provisorische Hochaltar mit
dem 1732 von Johann
Gebhard gemalten Bild des hl. Leonhard wurde 1736 ebenfalls von J.M. Doser mit vier Statuen versehen, nämlich dem
hl. Otto als Kloster- und Pfarreigründer, dem hl.
Nikolaus, der ja vorher
bereits in Pferrach besonders verehrte worden war, dem hl.
Heinrich als
Bistumspatron und dem hl. Quirin, wohl in Anlehnung an den damaligen Pfarrer P.
Quirin Öllhardt.
Von dem aus Südtirol stammenden und in Regensburg-Prüfening wirkenden Johann
Gebhard stammt auch das Bild des Erzengels Michael im Hochaltar oben. Den
hl. Florian in einer Nische der Nordwand mit Bildern der Kirche St.
Leonhard (links) und des Kloster Michelfeld (rechts) hat wohl sein Sohn
Otto (1703-1773)
gemalt.

1760 bis 1762 wurde der Hochaltar von dem einheimischen Maler
Johann Durban und von Dosers Sohn Augustin neu gefasst. Die Aufschrift
beinhaltet ein sog. Chronostichon, bei dem aus den Großbuchstaben in
lateinischen Ziffern die Zahl 1760 hervorgeht: „protege popVLVM zeLator sanCte
LeonarDe“, (zu deutsch „Schütze mit Eifer Dein Volk, heiliger Leonhard“).
Über dem Hochaltar ist das Wappen des aus Auerbach stammenden Abtes Marianus
Eder angebracht, der 1738-83 dem Kloster vorstand.
 |
 |
Nebenaltäre waren wohl zunächst (1732) nur zwei vorhanden, nämlich ein
Marien- und ein Magdalenenaltar. Die beiden kleineren Altäre, wahrscheinlich in
den seitlichen Nischen, waren ein Josephs- und ein Mariä-Hilf-Altar; sie wurden
um 1740 aufgestellt. 1742 ersetzte man die bisherige Orgel durch eine neue, 1750
wurde als dritte Glocke eine große, fast 4 Zentner schwere
Dreifaltigkeitsglocke angeschafft. 1757 ließ die Pfarrei dann die Kirchendecke
von St. Leonhard durch Meister Albini im Stile des ausgehenden Rokoko
stukkieren.
1783 wurde für die Pfarrkirche St. Leonhard ein neuer Taufstein angeschafft; es
ist wohl der, welcher heute in der Asamkirche steht.
Dies sind nur ein paar Beispiele für die zahlreichen und kostspieligen
Aufwendungen, die damals von der Pfarrei Michelfeld für ihre Pfarrkirche St.
Leonhard geleistet wurden. (nach 2, Seite 22 ff)
Ölberg und Wieskapelle
Wie bei vielen anderen Kirchen, z.B. bei der Auerbacher Pfarrkirche, war
auch an St. Leonhard ursprünglich ein spätmittelalterlicher Ölberg an der Südseite
des Gotteshauses angebaut. Die Fundamente dazu fand man bei der Trockenlegung
der Grundmauern 1981 in der Nähe des Turmes.
 |
Ebenfalls wie in Auerbach war auch
in Michelfeld der Ölberg mit seinen Statuen aus der Zeit um 1500 beim
Bildersturmmandat des Kurfürsten Friedrich von 1567 zugemauert und damit
gerettet worden. Erst mit dem Abbruch der Brandruine von St. Leonhard anno 1725
wurde wohl auch der alterwürdige Ölberg abgetragen. 1745 jedenfalls wurde die
heutige Ölbergdarstellung errichtet. |
In enger Anlehnung zur bekannten und weltberühmten barocken
Wieskirche bei
Steingaden in Oberbayern, der Wallfahrtskirche zum „Heiland an der Geißelsäule“,
wurde auch in Michelfeld 1747 eine Wieskapelle errichtet. 10 Jahre danach ließ
die Pfarrei diese ebenfalls durch Rudolf Albini ausstukkieren. Die Wieskapelle
diente ursprünglich nur als Gebets- und Andachtsraum und wurde später auch als
Aussegnungshalle verwendet.
Blütezeit der Pfarrei und von St. Leonhard
Pfarrer Wolfring schreibt über diese Zeit: „Die Pfarrkirche St.
Leonhard war also mit Kunstgegenständen reich ausgestattet. Mitte des 18.
Jahrhunderts war ein Höhepunkt des kirchlichen Lebens in Michelfeld.. ... Das
religiöse Leben der Pfarrei entfaltete sich in einer barocken Üppigkeit und
die Folge davon war auch die Anschaffung kirchlicher Kunst- und
Einrichtungsgegenstände. ... Die Lebens- und Glaubensfreude der Menschen im 18.
Jahrhundert muß lebendig und übersprudelnd gewesen sein. In der
Kirchenrechnung trifft man da auf Spuren. Da ist die Rede von Kelchen und
Monstranzen, von Glocken und Fahnen und Weihrauchfässern, von neuen Traghimmeln
und Versehglöckchen und -laternen, von Ciborien (Anm.:
Kelche für die geweihten Hostien mit Deckel, der in der Gotik gelegentlich die
Form eines Turmhelmes hatte) und Versehpyxen, eine mit dem
Bild des hl. Leonhard, von großen und kleinen Messing- und Zinnleuchtern.
Kruzifixe, kupferne Weihwasserkessel, Ampeln für das ewige Licht und eine
kleine beim Marienaltar, Taufschüsseln, kupferne Pauken, Musikinstrumente und
Meßgewänder, ein St. Michaelsbild im Beinhäusl, Ministranten- und Chorröcke,
ja sogar drei gemalte Totenköpfe, ein schönes neu angeschafftes
Christkindlein, ein neues Sakristeiglöcklein - alles das wird aufgezählt ...
und man spürt dahinter das überquellende und pulsierende Leben der Pfarrei St.
Leonhard in Michelfeld in all diesen glücklichen Jahren, ... daß in allen
Dingen Gott verherrlicht werde, ... wie der hl. Benedikt in seiner Regel im 5.
Kapitel schreibt.“ (2, Seite 29ff )
Die Säkularisation
Mitten in diese Blütezeit des religiösen Lebens in Michelfeld zog ein
schweres Gewitter auf: die
Säkularisation von 1803, mit der die Auflösung des
Klosters verbunden war. Zwar konnte der Staat nicht unmittelbar in die Rechte
der Pfarrei eingreifen, „jedoch geriet St. Leonhard und die Pfarrei ... in den
Strudel der Ereignisse: Der Staat hatte Hand an die Wurzel des Baumes gelegt,
und wenn der Baum - die Abtei Michelfeld - umgehauen wurde, dann war auch der
Ast, die Pfarrkirche St. Leonhard, davon berührt“. (2, Seite 39)
Die kurfürstliche Regierung bestimmte die bisherige Klosterkirche St. Johannes
der Evangelist als neue Pfarrkirche, und sah die bisherige als überflüssig an.
(3, Seite 206ff)
Doch mit diesem scheinbar großzügigen Vermächtnis
kamen auch übergroße Aufgaben auf die Pfarrei zu: „Wer sollte diese
prachtvolle Asamkirche unterhalten? Woher sollten die Mittel dafür kommen? Was
sollte mit der ehemaligen Pfarrkirche St. Leonhard geschehen? Und mit dem Ölberg
und der Wieskapelle?“ (2, Seite 39) "Vieles von der Einrichtung der
Kirche ist seither verloren gegangen. Da die alte Pfarrkirche in der
Säkularisation als überflüssig angesehen wurde und deshalb entweder
abgerissen oder profaniert werden sollte, wurde ein Teil der Kircheneinrichtung
verschleudert. Zwei Nebenaltäre gelangten 1803 nach Hopfenohe
und später, nachdem dieser Ort in den Truppenübungsplatz
Grafenwöhr einbezogen wurde, nach Troschenreuth. Drei Beichtstühle wurden der
Auerbacher Bergkirche übergeben. Die noch ganz gute Orgel - zweifelsohne die
Hößlerorgel von 1742 - bekam die Pfarrei Haag."
(4, Seite 89)
Im Bamberger Realschematismus (5, S. 217) heißt
es kurz und bündig über das weitere Schicksal der St. Leonhardskirche: „1803
als überflüssig zum Abbruch bestimmt und bis auf den Hochaltar ausgeraubt,
1828 vom Pfarrer zurückgekauft und der Gemeinde geschenkt, als Friedhofskirche
verwendet.“
Im nun folgenden Jahrhundert wurde die Leonhardskirche noch
des Öfteren im Kirchenjahr genutzt. Auch wurden immer wieder Maßnahmen zum Gebäudeerhalt
vorgenommen, so in den 60er Jahren vom damaligen Pfarrer Hans Müller (1947-76
in Michelfeld). „Dies endete erst in den vergangenen Jahrzehnten“, schrieb
Pfarrer Wolfring 1982. Und weiter: „Bedauerlicherweise kamen St. Leonhard, der
Ölberg und die Wieskapelle immer mehr herunter. ... Während der letzten
Jahrzehnte schlummerte sie in einem Dornröschenschlaf. Ja man kann sogar sagen:
Es war ein Aschenputteldasein, das diese ehemalige Pfarrkirche führen mußte.
Untäter drangen ein und demolierten die Orgel und die Orgelpfeifen auf der
Empore wie Vandalen.“ (2, Seite 41)
Renovierung
von St. Leonhard
 |
Der Weitsicht und Tatkraft von
Franz Wolfring (* 24.8.1928),
der vom Jahr 1979
bis zu seinem
plötzlichen Tod
am 24. März 1987
Pfarrer in Michelfeld war,
ist es zu
verdanken,
dass St. Leonhard wieder
ein echtes Schmuckkästlein
und vor allem
ein
vollwertiges Gotteshaus wurde.
Pf. Wolfring hat auf dem
Michelfelder
Friedhof
seine letzte Ruhestätte.
|
Praktisch ab 1982 liefen die
Renovierungsmaßnahmen
im Michelfelder Friedhof auf Hochtouren. Ab 1984 konnten die Wieskapelle und der
Ölberg fertiggestellt werden. Am 27. Dezember 1986 wurde die neue Orgel in St.
Leonhard in Dienst gestellt, und am 12. November 1988 erhielt schließlich der Hochaltar
seine feierliche Weihe.
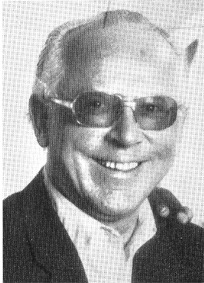 |
Der Initiator und Motor der Renovierung
von St. Leonhard in Michelfeld,
Pfarrer Franz Wolfring (1928-1987)
durfte die Fertigstellung
und Einweihung (12.11.1988)
leider nicht mehr erleben. |
Während der Renovierung der einstigen Kloster- und
heutigen Pfarrkirche St. Johannes der Evangelist (Asamkirche) erfüllte St.
Leonhard ca. fünf Jahre lang wieder die ursprüngliche Funktion für die
Pfarrgemeinde Michelfeld. Seither finden zahlreiche Gottesdienste in der
ehemaligen Pfarrkirche statt, so z.B. die Requien für die verstorbenen
Gemeindemitglieder.
Ein Besuch der Michelfelder Friedhofskirche St. Leonhard lohnt sich auf jeden
Fall, nicht nur für Beter. Das Gotteshaus ist tagsüber bis zum Gitter offen.
Sachkundige Führungen können mit Luitpold Dietl
(09643 1511) vereinbart werden. (Webseite der
Pfarrei)

verwendete und weiterführende Quellen
| 1 |
Lindner,
Johannes, Festbuch 875 Jahre Pfarrei Michelfeld, 1121-1996, Michelfeld
1996 |
| 2 |
Wolfring, Franz, Über St. Leonhard, Ölberg
und Wieskapelle in Michelfeld, maschinengeschriebenes und
unveröffentlichtes Werk über die Pfarrei Michelfeld, 1982 |
| 3 |
Weber, Rudolf, 900 Jahre Kloster
Michelfeld, Auerbach 2019 |
| 4 |
Schnelbögl, Fritz, Zur Geschichte von St. Leonhard
in Michelfeld, in Ostbairische Grenzmarken, Passauer Jahrbuch für
Geschichte, Kunst und Volkskunde, Jhrg. 19, 1977 |
| 5 |
Realschematismus Bamberg, Bamberg 1960 |
 |
Cherubini,
Luigi (1760-1842)
Sanctus, aus dem Requiem in c-moll |
letzte Bearbeitung dieses Artikels am 29.
September
2024

 |
Wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen möchten,
können
Sie mich hier
oder
telefonisch unter 09643 683 erreichen.
Über Anregungen usw. freue ich mich.
|

 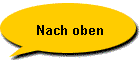
|