|
| |
Die
Auerbacher
Stadttürmer
Ein wichtiger Faktor der mittelalterlichen
Stadtbefestigung waren neben Mauern,
Türmen, Toren usw. sicher auch die
Türmer oder Turner, die Tag und Nacht über
den Dächern der Häuser, seit 1555 auf dem Kirchturm von luftiger Höhe aus, über Auerbach und die Umgebung
wachten.
.jpg)
aus einem
Flyer des
Türmermuseums Vilseck (Quelle 4)
Die ersten Türmer
in Auerbach
Seit der Marktgründung Auerbachs und der gleichzeitigen Pfarreierhebung anno 1144
gab es zwar einen Kirchturm, aber keinen Türmer auf diesem. Der ursprünglich
romanische Turm von 1144 und von 1314, der bis zur Zerstörung durch die Hussiten 1430 neben der
Pfarrkirche stand, war unbewohnbar, und wegen seiner relativ geringen Höhe
nicht als Beobachtungsturm geeignet.
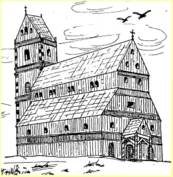 |
 |
|
Kirche 1144 |
Kirche 1314 |
Den für die Stadt so wichtigen Wachtdienst
versahen bis Mitte des 15. Jahrhunderts ausschließlich die „Thorwärtl“ auf den Türmen der 3 Stadttore.
Auch als der neue Turm bei der Pfarrkirche 1445 fertig gestellt war, sollte es noch 110 Jahre dauern,
ehe durch den Bau eines weiteren Stockwerkes die Türmerwohnung hoch oben über
den Dächern der Kirche und der ganzen Stadt eingerichtet
wurde. Seit 1555 gab es damit einen „Stadttürmer“ oder „Stadtturner“ in
Auerbach auf dem Kirchturm.
Dass er
Kirchturm heißt und die Kirchenglocken beherbergt, aber im Eigentum und
damit in der Baulast der Stadt Auerbach ist, sei nur am Rande erwähnt.
Doch nun zu
den Türmern.
Türmer auf dem Kirchturm
Wer heute den Auerbacher Kirchturm besteigt, um gleichsam aus der
Vogelperspektive die weite Aussicht zu genießen, wird kaum daran denken, dass
jahrhundertlang Menschen diesen relativ beschwerlichen Weg nach oben und wieder
nach unten mehrmals am
Tag zu gehen hatten, um Ausschau zu halten zum Schutze der Stadt und ihrer
Bewohner. Der Turm war bis zum verheerenden Stadtbrand von 1868 sogar noch ein
Stockwerk höher.
|

|
Auf dieser
ca. 100 Jahre
alten Ansichtskarte
ist
eindrucksvoll
zu sehen, wie weit
der Kirchturm
die Stadt Auerbach
überragt. |
Die Türmer oder Turner,
auf dem Kirchturm hatten nun bis zu Beginn des 20.
Jahrhundert als städtische Angestellte diese sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen.
Vom Kirchplatz aus
misst das höchste Bauwerk
der
Stadt heute 61,50 m,
die Grundfläche des Turmes
ist ein Quadrat mit 8 m Seitenlänge.
Im 1. Stock sind die Mauern 2,40 m
stark, im 5. noch 1,60 m
und im 10. „nur
noch“ 0,90 m.
Wenn man mit gutem Recht
das Jahr 1441 als Baubeginn
annimmt, so
hat der Turm
das ehrwürdige Alter
von über 560 Jahren.
|
 |
Die ersten „Turner“
auf dem Kirchturm entstammten wohl der Familie Dillmann. Sie wie alle ihre
Nachfolger hatten zahlreiche Pflichten zu erfüllen. So hatten die Türmer Tag
und Nacht den Wachtdienst zu versehen und bei einem Brand die Feuerglocke, bei
einem Gewitter die Wetterglocke, bei einem Todesfall das Sterbeglöcklein, bei
einer Hinrichtung das Armesünderglöcklein zu läuten. Wenn feindliche oder
einfach unbekannte Personen die Stadt umschlichen oder gar Verdächtige sich den
Toren näherten, dann waren mit dem Horn oder der Glocke bestimmte Signale zu
geben. Auch wenn besonders hochgestellte Personen nahten, mussten die Türmer
dies mit einem besonderen Signal ankündigen, damit der Bürgermeister mit Gefolge
zum entsprechenden Tor eilten, um den hohen Gast gebührend zu empfangen. (siehe
weiter unten bei Versäumnisse der Turner)
Abends 11 Uhr wurden die Stadttore zugesperrt. Der Türmer hatte dabei
das Sperrglöcklein oder den „Hußaus“ zu läuten.
Tag und Nacht musste der
Türmer vom Turm die vollen Stunden nachschlagen.
 |
Nachts musste
der Türmer
zu jeder
Viertelstunde
ein Hornsignal geben,
das vom Nachtwächter
unten in der Stadt
erwidert werden musste.
Dies war eine Art
gegenseitiger Kontrolle,
dass weder
Turner
noch Nachtwächter
ihre Aufgaben vernachlässigten,
und vielleicht gar
einschliefen. |
Türmer und „Stadtpfeifer“
Wie in jeder anderen Stadt, so gab es auch in Auerbach einen „Stadtpfeifer“,
der bei Festzügen vorausgehen und aufspielen musste, bei Kindstaufen und
Hochzeiten den Dudelsack oder die Sackpfeife blies, zum Tanz aufspielte und vor
allem auch bei den feierlichen Gottesdiensten in der Kirche mitwirkte. Als der
Magistrat 1555 einen Stadttürmer anstellte, übernahm dieser auch das Amt des Stadtpfeifers; vielleicht war der erste Turner der bisherige Pfeifer.
|

|
Aus diesem zusätzlichen Amt heraus erwuchsen dem Türmer weitere Aufgaben.
So hatte er
dreimal am Tag von der Galerie des Turmes zusammen
mit 2 Gesellen fröhliche Weisen „abzublasen“,
und zwar um 2 Uhr und um 10 Uhr in der Früh, und um 18 Uhr abends;
im Winter um
4 Uhr, um 10 Uhr und um 16 Uhr.
Dabei war genau festgelegt, dass jeweils „3 Stücklein“
auf die Stadttore zu geblasen werden mussten. |
Auch bei der Kirchenmusik hatte der Turner gegen geringen Lohn mitzuwirken; er
hatte aber dafür das Privileg, dass nur er bei Kindtaufen, Hochzeiten und
Kirchweihfesten
gegen Entgelt aufspielen durfte. Dabei machten ihm allerdings über die
Jahrhunderte hinweg andere Musikanten, oftmals die Stadthirten, Konkurrenz und
„schnappten ihm das Brot weg“.
Kamen hohe Herrschaften auf Besuch in die Stadt, so musste sie der Turner schon
aus der Ferne „anblasen“ und ihnen später in ihrer Herberge mit seiner
Musik aufspielen.
Versäumnisse der Turner
Bei den zum Teil doch recht genau festgelegten Aufgaben blieb es nicht aus, dass
ein Türmer schon mal seine Pflicht verletzte und dafür bestraft wurde. In den
alten Ratsbüchern und Stadtkammerrechungen wimmelt es geradezu von derartigen
Vorkommnissen.
So erhielt z.B. am 9. Juli 1660 der Türmer Sigmund Muckensturm vom Rat einen
sehr strengen Verweis, weil er die „schweren Gewitter nit rechtzeitig
angeschlagen und weggläut“ habe. Der gleiche Turner wurde am 25. Juni 1662
drei Tage bei Wasser und Brot in den Kollerer gesperrt, weil er die Ankunft des
Bamberger Bischofs falsch signalisiert hatte. Als sich nämlich auf sein Signal
hin bereits ein Festzug der örtlichen geistlichen und weltlichen Honoratioren
dem hohen Gast entgegenbewegte, musste der Türmer mit Schrecken vermelden, dass
es nicht die erwartete bischöfliche Reiterei war, die er von Michelfeld
herkommend angekündigt hatte, sondern eine Kuhherde.
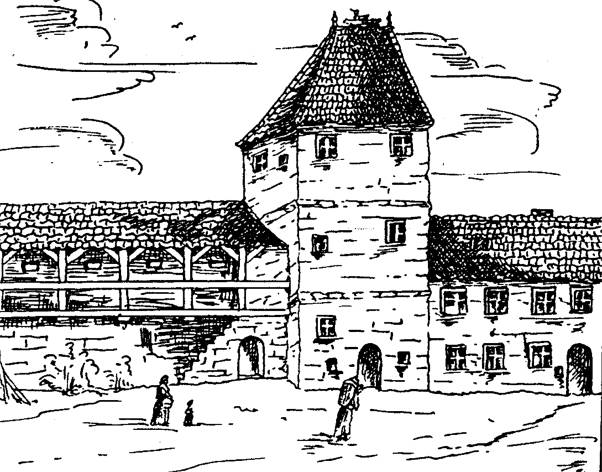 |
„Kollerer“
wurde damals
das städtische Gefängnis
genannt, welches sich
im ebenerdigen Gewölbe
des „Predigerturmes“,
heute Pfarrstraße 15,
befand. |
Unter dem 28. Januar 1678 kann man lesen, dass der Türmer Daniel Schrumpf
24 Stunden bei Wasser und Brot in den Kollerer gesperrt wurde und am nächsten
Tag sein Geselle und sein Lehrjunge ebenfalls, weil alle drei die Feuersbrunst
an der Zogenreuther Mühle übersehen hatten.
Die Türmergenerationen
Peißner
Mit der Anstellung von Zacharias Ignatius Peißner genannt Turnernazi, aus Hirschau am 1. Februar
1692 übernahm diese Familie den Türmerdienst in Auerbach für die nächsten
206 Jahre.
Sein Sohn Johann Jakob Georg Peißner (ca. 1707-1772) übernahm 1756 den
Dienst als Türmer auf der Burg Dagestein
in Vilseck. Bis 1911 waren die Peißner dann Türmer in der Stadt Vilseck. (4,
Seite 13ff) Ein Abkömmling war
Elias Peißner, der als Student in München am 18. Juni 1847
Lola Montez kennen
und bald auch lieben lernte. So wurde er zum Nebenbuhler von
König Ludwig I.
(1786-1868, reg. 1825-1848). Im Museum Vilseck wird ein Reisekleid gezeigt, das
Lola Montez 1848 bei ihrer Flucht aus München und einer kurzen Zwischenstation
in Vilseck hier zurückgelassen haben soll. (mehr)
Über dieses Geschlecht findet man Interessantes in den alten Ratsbüchern von
Auerbach.
So heißt es z.B. über den „Turnertani“ Anton Peißner, der von 1720-40
amtierte, dass er ein populärer Mann war, der einen guten Trunk nicht verschmähte
und wie alle Peißner ein vortrefflicher Musiker war. Er wurde am 13. Mai 1740
arretiert, weil er „statt des Sterbglöckls das Feuerglöckl derwischt“ und
durch den falschen Alarm Angst und Schrecken verbreitet hatte.
Da der jeweilige Türmer zugleich Dirigent und Anführer aller städtischen
Musikanten war, bekam er allgemein den Beinamen „Turnerprinz“. Auf diesen
Titel waren auch die Auerbacher Türmer sehr stolz. „Die Familie Peißner war
mehr als die meisten anderen Türmer zu diesem Stolz berechtigt, denn alle ihre
Glieder waren vorzügliche Musiker und das Virtuosentum auf der Violine pflanzte
sich 200 Jahr lang stets vom Vater auf den Sohn und Enkel fort.“ So urteilt
Joseph Köstler (1849-1925) in seiner umfangreichen Stadtgeschichte.
(1, Seite 140)
In die Amtszeit von Karl Peißner (1850-70) fiel der große Stadtbrand am 27.
Juni 1868, bei dem auch der Kirchturm von der untersten Etage bis zur Spitze
ausbrannte. Die Peißner siedelten sich nun unten in der Stadt an und bezogen den
Turm auch nach dessen Restaurierung nicht wieder. Als Wächter auf dem Turm
versahen in den folgenden Jahren Auerbacher Bürger ihren Dienst, und zwar der
Schuhmacher Georg Wolf (1870-72), der Schuhmacher Leonhard Reger (1872-78) und
der Schneider Johann Popp (1878-98).
Johann Peißner (1854-1907) heiratete 1880 die Margareta, eine Tochter des
bürgerlichen Metzgermeisters Johannes Fellner (HNr 230, heute Oberer
Marktplatz 6) und seiner Ehefrau Margareta, geb. Neumüller von HNr 234 (heute
Oberer Marktplatz 10).
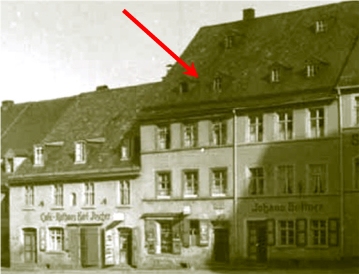 |
Dieses Haus Nr. 230
(heute Oberer Marktplatz 6,
Hausname beim Schmittschouster)
gehörte 1882-1901
dem Stadttürmer Johann Peißner;
er hatte es durch seine Heirat
mit der Fellnertochter bekommen.
Sein Schwager Michael Fellner
erwarb 1882 Anwesen Nr. 69
(heute Oberer Marktplatz 14)
und betrieb dort das Gasthaus "Zum Schwan".
(nach 2,
Seite 274) |
Das
Ehepaar Peißner hatte zwei Kinder, von denen Sohn
Karl (1890-1952) ein erfolgreicher Musiker und
Komponist
wurde. (nach 2, Seite 274) Bruno Peißner, einer der beiden Söhne des
Karl P., besuchte vor kurzem die Wirkungsstätte seiner Vorfahren hier in
Auerbach.
|
Johann
Peißner (Pfeil)
mit seiner Frau Margareta,
den Kindern Margarete (rechts)
und Karl (2. von rechts),
sowie seiner Schwester mit Tochter. |
 |
1898
legte Johann Peißner das Türmeramt nieder und wurde Chorregent in Auerbach, wo
er 1907 starb. (über die Türmer Peißner s. auch 3)
Der letzte Stadttürmer
Als letzter Turner von Auerbach fungierte daraufhin bis 31.12.1910 der Schuster
Johann
Baptist Metz (1875-1950), Großvater des wohl bekanntesten deutschsprachigen katholischen
Theologieprofessors
(+2.12.2019) gleichen Namens unserer Tage.
(J.B. Metz,
Nachruf)
Türmer Metz verlegte seine Wohnung bereits um 1900 vom Turm in das daneben stehende älteste
Schulhaus der Stadt, auch
Köstler-Schulhaus genannt. Im Volksmund heißt das der Kirchenverwaltung
gehörende und von dieser bis 2023 aufwändig sanierte Gebäude auch
Metz-Schulhaus.
ak.jpg)
Metz lebte
mit seiner Familie auch nach
Abschaffung des Türmeramtes durch die Stadt weiterhin in diesem nach ihm
später so benannten Metz-Schulhaus (Pfarrstraße
5; Foto),
und versah den Mesnerdienst in der Pfarrkirche.
Mit Johann Baptist Metz erlosch an
Silvester 1910 in unserer Stadt Auerbach ein Berufsstand, der nahezu ein
halbes Jahrtausend zum Wohle der Bürger sozusagen von oben herab als
Türmer gewirkt
und gewacht hatte.
verwendete
und weiterführende Quellen
| 1 |
Köstler,
Joseph, Chronik der Stadt Auerbach, Band VIII, Teil 1 des
siebenundzwanzigbändigen, handgeschriebenen Werkes, Lagerort Stadtarchiv
Auerbach |
| 2 |
Kugler,
Hans-Jürgen, Auerbach in der Oberpfalz - Die Geschichte seiner Häuser
und Familien, Band 2, Auerbach 2010 |
| 3 |
Polaczek, Barbara, Erstes Deutsches
Türmermuseum Vilseck, Vilseck 2000 |
| 4 |
Türmermuseum
in Vilseck |

 |
Hört
ihr Herrn und lasst euch sagen ... |
letzte Bearbeitung dieses
Artikels am 19. Januar 2024

|
Wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen möchten,
können Sie mich hier
erreichen
oder telefonisch unter 09643 683. |
 |
 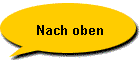
|