|
| |
Christianisierung
unserer Heimat
Christi Geburt, die Zeitwende, und damit der Beginn einer völlig
neuen Ära, war noch weit entfernt, als auch bei uns schon
"Geschichte" begann.
Johannes Neubig, Verfasser der ersten gedruckten Chronik Auerbachs von 1839,
schreibt in seiner blumigen Sprache über die vorgeschichtliche Zeit u. a.:
"Die geschichtliche Farbe unserer Gegend
... war viele Jahrhunderte vor und nach Christi Geburt nur wilde
Natur, in der unheimlichen graunhaften Gestalt nur sich selbst überlassen. Denn
wo jetzt Menschen wohnen, da hauste dereinst gar rohes Vieh, da schattete fürchterlichfinsteres
Urgewälde, da hatte das niedere Land tief schwimmen gelernt und faulte in
Wassersucht von Sümpfen und Seen ersauft. ... Näher und näher zog der erste
Morgenstrahl über Auerbachs uralte, menschenleere, dichte Nacht, als die
Bojarier (Anm.: Bajuwaren) gen Norden über die Donau herauf ihre Wohnsitze nach und nach
auch in dem Nordgau
(Anm.: etwa die heutige Oberpfalz) ansiedelten und ihre Herrschaft ausbreiteten.
Wohl noch ein schwaches, schwaches Morgenroth; denn in den finsteren Schoß des
Waldes selbst, aus dem einst unser nordgauisches Auerbach entsteigen sollte, war
der Blitz noch keines belebenden Sonnenstrahls gedrungen. Damals wurde das
innerste Eingeweide unserer Wälder nicht so mit Sägen und Äxten aufgeklärt
wie jetzt, nicht so leicht und schnell mit Menschen bekannt wie jetzt." (1,
Seite 2f)
Erste Spuren von Menschen
finden wir bei uns in der Frühgeschichte "vom 5. Jahrtausend
v. Chr. über die Kelten- und Römerzeit bis ins 8.
Jahrhundert n. Chr., wo die ersten Urkunden die mittelalterliche Geschichte
beginnen lassen." (2, Seite 24ff)
Wenn auch sicher nur vereinzelt, so waren Menschen
schon ab Ende der Mittelsteinzeit (ca. 8.000 bis
5.000 v. Chr.) in unserer
Gegend anzutreffen, wie z.B. Funde aus dem Raum Weidlwang und
Ranna zeigen.
Die zahlreichen Grabhügel
bei Ortlesbrunn entstanden in der Hallstattzeit
und der frühen Latènezeit,
zwei geschichtlichen Abschnitten vor Christi
Geburt,
die beide zur „Eisenzeit“
gehören.
Wohl
im Zuge oder als Folge der Völkerwanderung im 3. bis 6. Jahrhundert
n. Chr.
verschlug es dann mehr Siedler in unsere Heimat.
Die Religion unserer Vorfahren
In der "Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den
nichtchristlichen Religionen" des II. Vatikanischen Konzils (1962-65) heißt
es u. a.: "Von den ältesten Zeiten bis zu unseren Tagen findet sich bei den
verschiedenen Völkern eine gewisse Wahrnehmung jener verborgenen Macht, die dem
Lauf der Welt und den Ereignissen des menschlichen Lebens gegenwärtig ist, und
nicht selten findet sich auch die Anerkennung einer höchsten Gottheit. ...
Diese Wahrnehmung und Anerkenntnis durchtränkt ihr Leben mit einem tiefen
religiösen Sinn." (3, S. 356)
Unsere Vorfahren waren in diesem Sinne religiös, wie auch Joseph Köstler
(1849-1925), der andere große Chronist Auerbachs, beschreibt. "Die
Bewohner unserer heimatlichen Gaue waren zwar Heiden, aber ihre Religion kannte
keinen Kannibalismus, keine Menschenopfer, wahrscheinlich auch kein Priestertum.
Sie hatten kein einheitliches Religionssystem, sondern mengten unter die alten
religiösen Gebräuche der Kelten und Narisker auch die ganz anders gearteten
Gebräuche der Wenden. Großen Einfluß auf die Religion übten jedenfalls die
Thüringer aus. Sie mischten unter das keltisch-slawische Heidentum den
nordgermanischen Götterglauben. ... Da aber unsere Urahnen Kinder des Waldes
waren und ein tiefes Gefühl für die Natur, für die Gestirne, für Berg und
Wald und Wasser hatten, so blieben von all den fremden Glaubenssätzen nur jene
haften, die auf die Vorgänge in der Natur, auf Sonne, Mond und Wind, Quelle,
Baum und Feld Bezug nahmen oder die sich an die Haustiere und Feldfrüchte, an
Stall und Feld knüpften, oder auf das Schicksal der Menschen und ihrer Unternehmungen
bestimmend waren. ... Schöne Haine waren ihre Gotteshäuser, sprudelnde Quellen
und markante Felsen ihre Kultusstätten." (4, Seite 29)
Ihr oberster Gott war Wodan, der
Sonnengott, der den Winter und die Nacht besiegt, von dem Tag und Nacht, Wind
und Regen, Wachstum und Gedeihen kommt, der die 4 Jahreszeiten macht und Mond
und Sterne regiert." (4)
Frühe Spuren des Christentums
Eine erste Kunde des Christentums kam wohl schon gegen Ende des zweiten
nachchristlichen Jahrhunderts mit den römischen Kaufleuten, Beamten und
Soldaten über die Alpen in unsere Heimat. Die Römer hatten ja auch vorher schon seit ihren Eroberungen ab 15 vor
Christus unter Drusus und Tiberius, den Stiefsöhnen des Kaisers
Augustus (63 v.
Chr. bis 14 n. Chr.), ihre diversen römischen Götter und den persischen
Mithraskult mitgebracht. Von den Christenverfolgungen unter Kaiser Diokletian
(284-305 röm. Kaiser) wurden auch die römische Provinzen Noricum und Raetien mit dem 179 n.
Chr. unter Kaiser Marc Aurel errichteten Kastell Castra Regina, dem
heutigen Regensburg,
nicht verschont.
|
Der bekannteste Blutzeuge
aus dieser Epoche
ist der hl. Florian,
der als römischer Offizier
und Beamter 304
in der Enns ertränkt wurde.
Dieser Florian
stammt wohl von
Johann Michael Doser
und steht seit 1716
in einer Nische
des Hauses Nr. 9 der
Dr.-Heinrich-Stromerstraße
(beim Langerfranzn)
in Auerbach. |
 |
Der hl. Florian ist u. a. Schutzpatron der
Feuerwehrleute.
Die hl. Afra
war ebenfalls mit den Römern ins Land gekommen und starb im gleichen Jahr auf einer Lechinsel nahe der damals rätischen
Provinzhauptstadt Augsburg auf dem
Scheiterhaufen für ihren Glauben. In Regensburg ist der Grabstein der
Sarmannina mit dem Christusmonogramm aus der Zeit um 400 ein frühes, vielleicht
das älteste christliche Zeugnis unserer Gegend.
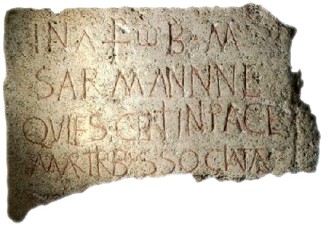 |
Neben dem Christussymbol und
den griechischen
Buchstaben Alpha und Omega trägt der Stein die Inschrift:
"Zum
seligen Gedenken an Sarmannina,
die in Frieden ruht, mit den Märtyrern
vereint." (11)
(Teil einer
Grabplatte, Das Bistum Regensburg I, S. 5)
|
"Das Christentum kommt heimlich ins Land. Während den römischen Göttern
Tempel errichtet und Opfer dargebracht werden, feiern die Anhänger der Lehre
Christi ihre Gottesdienste nur im Verborgenen." (5)
Erst das später so
genannte
"Mailänder
Edikt"
Kaiser Konstantins von 313
garantierte
Religionsfreiheit
im römischen Reich und stellte somit
das Christentum
den
anderen Religionen gleich.
Dort heißt es u. a.:
|
 |
"Nach sorgfältiger Prüfung alles dessen, was
dem Wohl und dem Frieden des Staates von Nutzen sein kann, haben wir geglaubt,
daß unter anderen den meisten Menschen dienstbaren Dingen vor allem das geregelt
werden müsse, was sich auf die der Gottheit gebührende Achtung bezieht, so daß
den Christen und allen anderen die Möglichkeit gegeben werden kann, sich zu der
von ihnen gewählten Religion frei zu bekennen." (6)
Es sollte allerdings noch einige Jahrhunderte dauern, bis unsere Vorfahren dann
wirklich näher mit dem Christentum in Berührung kamen. Mit dem Zurückdrängen
der Römer durch die Franken und die Männer aus Baia, die Bajuwaren, im 5. und
6. Jahrhundert, verlor zunächst sicher auch das frühe Christentum bei uns
wieder an Bedeutung.
Iro-schottische Mission
Die eigentliche erste richtige Missionierung unserer bayerischen Heimat ging
erstaunlicherweise nicht vom Süden, von Rom aus, sondern kam aus dem Norden.
In Britannien, genauer in den ehemals römischen Provinzen Britannia Interior
und Superior, hatte das Christentum schon in römischer Zeit Fuß gefasst; am
Konzil von Arles 314 nahmen bereits die Bischöfe von York, Lincoln und London
teil. Als allerdings 407 die Römer abzogen, erlosch das Christentum in
Britannien nahezu wieder. Doch zuvor war der Funke der neuen Religion bereits
auf das nahe Irland übergesprungen; der Brite Patrick (ca. 385-461) gilt als
der eigentliche Missionar der Insel.
Der hl. Patrick
ist
Nationalheiliger von Irland,
und der St.
Patrick's Day (17. März)
der Nationalfeiertag der Iren.
Patrick soll die Dreifaltigkeit
mit einem Kleeblatt
erklärt haben.
Ein Kleeblatt wurde deshalb
zu einem Symbol Irlands.
Patrick gilt als Patron der Bergleute,
Schmiede, Friseure und Böttcher,
des Viehs, gegen Ungeziefer,
gegen Viehkrankheiten und
Anfeindungen des Bösen.
Seine besondere Fürsprache
wird für die armen Seelen erbeten. |
 |
"Typisch für die städtelose Insel
wurde der monastische Charakter des gesamten kirchlichen Lebens. ... Das irische
Mönchtum war trotz seines starken anachoretischen (d.h. zurückgezogenen)
Charakters keineswegs weltflüchtig, sondern voll von enthusiastischem
Aktionsgeist, der sich in einem starken Missionsgeist äußerte. Der Zug zur
Einsamkeit und zur Absonderung trieb sie in die Ferne, ins Elende. Um Christi
willen heimatlos und doch überall beheimatet, durchzogen sie Gallien, Italien
und Germanien bis hin nach Pannonien. Die heilige Pilgerschaft, das Peregrinari
pro Christo, war ihr aszetisches Ideal. Die bärtigen rauhen Gestalten mit dem
langen Wanderstab in der Hand, dem kahlgeschorenen, nur von einem schmalen
Haarkranz umgebenen Vorderteil des Schädels, von dessen Hinterteil das lange
Haar wallend herabfiel, boten einen seltsamen Anblick. Über die Schultern
trugen sie an einem Riemen die Wasserflasche und einen Ledersack, in dem ihre Bücher
verpackt waren; am Halse führten sie eine Reliquienkapsel und ein Gefäß zur
Aufbewahrung der konsekrierten heiligen Hostien mit sich." (7)
So ist es nicht verwunderlich, dass diese irischen Wandermissionare auch in
unsere Heimat kamen. "Am Anfang bayerischer Kirchengeschichte stehen die
Iro-Schotten und ihre Mission. Voll Leidenschaft hatten die Kelten drüben auf
den Inseln das Christentum aufgegriffen und es durch die Stürme des 5. und 6.
Jahrhunderts weitergetragen - auch wenn die wirren Zeitläufte jede Verbindung
mit Rom abschneiden ließen. ... Aber immer noch trieb das keltische Blut in die
Ferne, und in den Tagen des heiligen Kolumban wurden iroschottische Wandermönche
zu den weitreichendsten Vertretern des Christentums überhaupt." (8)
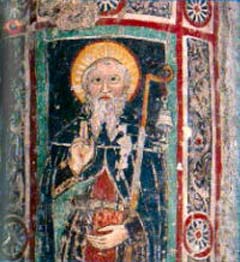 |
Diese
erste große
Missionierungswelle
ging also
schon um 600
von der irischen Mönchskirche
aus;
der hl. Kolumban (ca.
540-615)
sei hier stellvertretend
für die vielen Glaubensboten
dieser Zeit genannt.
|
Meist blieben die
Wandermönche nicht lange an einem Ort, weshalb
ihre Missionierung nicht in die Tiefe gehen konnte.
 |
Diese Statuen der Heiligen Kilian
(Mitte, Bischof),
Kolonat (links; auch Coloman)
und Totnan (rechts)
stehen als Kopien
(von Heinrich Schiestl) der
Riemenschneider Originale
in der Neumünster-Kirche
zu Würzburg.
|
Kilian kam zusammen mit seinen Begleitern
Kolonat und Totnan 686 n. Chr. nach Würzburg. Sie predigten und missionierten
bis ca. 689 und wurden dann gemeinsam ermordet. Der Legende
nach wurde der Mord von Gailana, der Frau des fränkischen Herzogs Gozbert von
Thüringen, angestiftet.
Die fränkischen Eroberer
In der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts kamen fränkische Eroberer in unsere
Gegend. Sie fanden ein raues und unwirtliches Waldgebiet vor, welches von
Nariskern, Thüringern und Slawen nur sehr spärlich bevölkert war. "Die
Franken eroberten das Land angeblich nur deshalb, um das Christentum einzuführen
und die Kultur zu fördern, aber das Christentum war ihnen bloß ein Vorwand und
der Deckmantel, unter dem sie ihre Habgier und Herrschsucht ungestört ausüben
und beschönigen konnten. Sie besetzten die vorhandenen Orte und gründeten
viele neue Dörfer und Kolonien. Sie setzten fast in jedes Dorf einen fränkischen
Reiter oder Ritter und verwalteten das Land mittels des Feudalsystems.",
(9) d.h., sie gaben den einheimischen Bauern gerodetes Land als Lehen und
verpflichteten sie zu verschiedenen Abgaben und zu Fron- und Kriegsdiensten.
"Das Bild zeigt
einen fränkischen Grundherrn,
vielleicht einen Grafen.
Es findet sich in Mals
(Vintschgau; ... am südl. Fuß
des Reschenpasses gelegen)
in einer kleinen Kirche
(St. Benedikt), deren Apsiden
vollständig bemalt sind.
Kirche und Gemälde stammen
aus dem 9. Jahrhundert."
(Quelle) |
 |
Einige kleinere Orte unserer Gegend bestanden also wohl bereits, die meisten wurden
aber in dieser
fränkischen Zeit bis zum 10. Jahrhundert erst gegründet. So lassen bekanntlich
Orte mit der Endsilbe "-reuth" darauf schließen, dass zunächst der
Wald ausgereutet, also gerodet werden musste. Bei diesen Ortsnamen weist
meistens die vordere Silbe auf den ersten Kolonisten, den Vorarbeiter bei den
Rodungsarbeiten, der durchaus auch ein Slawe sein konnte, oder eben den Gründer
der Ansiedlung hin; Zogenreuth (Zudo oder Zugo), Troschenreuth (Drogo oder
Drosco) und Treinreuth (bei Thurndorf; Dragon) enthalten z.B. wohl slawische
Namen. Gunzendorf (Gunzo bzw. Gundeloh) scheint dagegen einen deutschen Gründer
zu haben, bei Degelsdorf und Dammelsdorf ist dies noch offen. In diese Zeit vor
dem Jahre 1000 fallen auch die Ortsgründungen von Hopfenohe
(Ache, d.h. Bach,
an dem Hopfen, wahrscheinlich wilder, wuchs) und Hagenohe
(Ache am Hagen, d.h.
am Dornbusch), (Unter-) Frankenohe (heute im Truppenübungsplatz Grafenwöhr)
weist noch direkt auf die Franken hin.
"Zwar war bei jeder größeren Burg eine Kapelle und ein Priester, aber das
Heidentum dauerte doch immerfort, zumal in den abgelegenen und waldreichen
Gegenden. ... Der Presbyter streute zwar seinen Samen aus, aber im wilden Gestrüpp
und steinigen Grund gedieh keine Frucht. Die Jagd auf Hirsch und Auerhahn war
ihm vergnüglicher und ergiebiger, als die Seelenjagd. Mit Pfeil und Lanze wußte
er besser umzugehen als mit dem Buch der Bücher." (9) So urteilt Köstler
über diese fränkischen Missionierungsversuche ab dem 6. Jahrhundert, bei denen
wohl nicht allzu viel vom Christentum hängen blieb bei unseren Vorfahren.
Die "Apostel Bayerns"
"Die Wirksamkeit der irofränkischen Mission ist schwer abzuschätzen,
zumal aus Baiern keine frühmittelalterlichen Quellen vorliegen, die den Versuch
gemacht hätten, die Erinnerung an diese Männer wachzuhalten. Vermutlich war
ihr Wirken erfolgreicher, als dieses Schweigen annehmen läßt." (8)
"Freilich wird man im Bayern des 7. Jahrhunderts noch kein schlackenreines,
innerlich erlebtes Christentum suchen dürfen. Richtige Bauernart hält zäh am
Hergebrachten, spürt kaum einen Drang, von heut auf morgen den Väterglauben zu
wechseln, und Christliches und Heidnisches mochten oft in seltsamer Wirrnis nebeneinander stehen."
(10) So ist es auch nicht verwunderlich, dass im ältesten bayerischen
Gesetzbuch, der "Lex Baiuvariorum" um 630, ein Kapitel vom Verhexen
der Äcker und Felder handelt.
"Der breite Durchbruch des Christentums, der Bayern in ein geistliches Land
umzuprägen vermochte, scheint sich allerdings erst um und nach 700 vollzogen zu
haben, nicht zuletzt durch das Wirken der drei 'Apostel der Bayern', nämlich
der Abtbischöfe Emmeram,
Rupert und
Korbinian." (11)
 |
Jan Pollack,
der wichtigste Münchner Maler
des ausgehenden Mittelalters,
fertigte 1489 die Altartafel mit dem
Bärenwunder
des heiligen Korbinian
für den Dom
von Freising. |
Das Gedächtnis der "Apostel der bayern"
halten insbesondere die Bischofsstädte Regensburg, Salzburg und Freising bis heute in hohen
Ehren. Jedoch "die Missionare ... haben mit den Bayern ihre liebe Not, es
bedarf etlicher Anläufe und kostet einigen Predigern das Leben." (5) Der
hl. Emmeram starb z.B. um 683 bei München den Martertod.
Die angelsächsischen Missionare
Durch die iro-schottischen Mönche und die Abtbischöfe war zwar das Christentum
in weiten Teilen Bayerns eingeführt worden, eine innerkirchliche Organisation
und vor allem eine engere Verbindung mit Rom aber bestand zunächst nicht.
"In dieser Situation kamen angelsächsische Missionare zu Hilfe und führten
den entscheidenden Wandel herauf. Die Missionierung der angelsächsischen Kirche
selbst hatte Ende des 6. Jahrhunderts gleichzeitig von Rom aus auf Initiative
Papst Gregors I. und durch iroschottische Mönche eingesetzt. Trotz zeitweiliger
Spannungen war daraus eine fruchtbare Verbindung von irischer
asketisch-monastischer Frömmigkeit und römischem Geist entstanden. Wie die
Iren von Missionseifer erfüllt, entsandten die Angelsachsen ihrerseits
Missionare, die sich auf dem Festland der Reinigung und Festigung des gallofränkischen
Christentums widmeten" (12)
 |
Bonifatius,
Apostel der Deutschen
"Er
war der größte
der angelsächsischen Festlandsmissionare,
einer der
bedeutendsten
abendländischen Schlüsselfiguren,
der Wegbereiter
der christlichen
Völkergemeinschaft
Europas." (7)
(Statue
am Dom
in Fulda)
|
Gemeint ist der angelsächsische
Benediktinermönch Winfrith, besser bekannt unter dem ihm 719 vom Papst verliehenen
Namen Bonifatius (geboren um 672 in Wessex in Südwestengland, 732 Erzbischof
ohne festen Sitz und 737 Päpstlicher Legat für Bayern, Allamannien, Hessen und
Thüringen, also das gesamte ostfränkischen Missionsgebiet, 747 Erzbischof von
Mainz, als Märtyrer gestorben 754 im friesischen Dokkum, bestattet im Dom von
Fulda). Seine Bedeutung liegt dabei weniger in der Missionierung Deutschlands,
als vielmehr in seiner reformierenden und organisatorischen Tätigkeit.
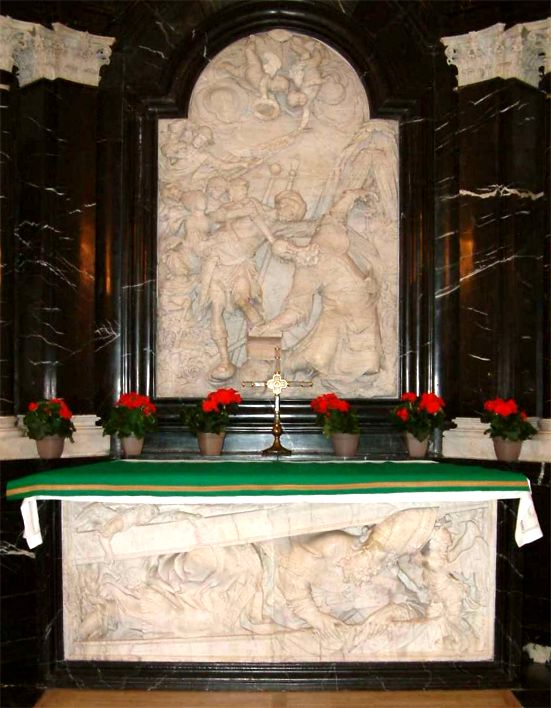 |
Das Bonifatiusgrab
in der Krypta
des Fuldaer Domes
ist
sozusagen
das Nationalheiligtum
der deutschen Katholiken.
Fulda ist auch der Sitz
der deutschen Bischofskonferenz.
|
"Bezeichnend für das englische
Mönchstum in jener Zeit ist die Gefolgschaftstreue, welche die völlige Hingabe
an Christus als den höchsten König und Richter verlangt. Darum auch ziehen
nicht nur einzelne aus, um den Heiden das Evangelium zu bringen, es sind
vielmehr oft ganze Familien, die dem Rufe des Herrn folgen und als Missionare in
ferne Länder auswandern. So ist Bonifatius der Anführer einer ganzen
Sippe, zu der manche der bekanntesten angelsächsischen Glaubensboten gehören.
Auch Lioba war mit ihm verwandt." (17, Seite 49) Lioba
von Tauberbischofsheim (um 700, bis 782), wie sie oft genannt wird, wird
besonders verehrt in den Diözesen Fulda, Würzburg, Mainz und Freiburg i.Br..
In Nürnberg ist die Filialkirche St.
Lioba der Pfarrei St. Bonifaz
ein kleines, sehr ansprechendes
neuzeitliches Gotteshaus.
Errichtung von Bistümern in Bayern
Bonifatius gelang es mit Hilfe von Herzog
Odilo (vor 700-748), den Auftrag von Papst
Gregor
III. (amt. 731-741) zur kanonischen Errichtung von
Bistümern in Bayern zu erfüllen. So wurden
739 die Bistümer
Regensburg,
Freising,
Passau (hier gab es allerdings schon den
zwischen 731 und 738 vom Papst geweihten Bischof Vivilo) und Salzburg
kirchenrechtlich gegründet und ihre Grenzen festgelegt. 741 kam
Würzburg dazu,
und weitere drei Jahre später wurde der Angelsachse Willibald erster Bischof
von Eichstätt; beide Bistümer gehörten zur Kirchenprovinz bzw. zum Erzbistum
Mainz.
Papst Leo III. errichtete 798 eine eigene bayerische Kirchenprovinz mit
dem Erzbistum Salzburg und den Bistümern Regensburg, Passau, Freising und
Säben
in Südtirol.
Unsere drei Nachbarbistümer Regensburg, Würzburg und Eichstätt entstanden
also etwa bereits ein Viertel Jahrtausend vor Bamberg.
Das Bistum
Bamberg, zu dem auch das oberpfälzische Auerbach gehört,
wurde erst 1007 von Kaiser
Heinrich
II. (um 973-1024; König HRR ab 1002; Kaiser 1014-1024)
gegründet.
 |
Der Bamberger Kaiserdom
St. Peter
und St. Georg
stammt
in seiner
heutigen äußeren Form
aus dem 13. Jahrhundert.
Er ist die Bischofskirche
der Erzdiözese Bamberg. |
Im Dorf Lindenhard, so meint Joseph Köstler, trafen sich damals die Bischöfe
Burkhard von Würzburg und Willibald von Eichstätt, um zusammen mit Bonifatius
die Grenzen ihrer Diözesen festzulegen. (13) Dabei wurden teils die Quell- und
Einzugsgebiete der Flüsse berücksichtigt, teils die politischen Grenzen
zwischen dem um 725 unter Karl Martell entstandenen bayerischen Nordgau und den
alten fränkischen Gebieten Rangau und Radenzgau. - Dieses Treffen in Lindenhard hat wohl nie
stattgefunden, denn einer anderen Quelle nach trafen sich Bonifatius und
Willibald mit dem baierischen Adeligen Suidger anno 740 in Linthart bei
Mallersdorf! (18, Band I, S. 10)
Das nahe Troschenreuth lag im Radenzgau (in pago Ratenzgowe) und scheint sehr früh
christianisiert worden zu sein. "Auch darf ein anderer kirchlicher
Mittelpunkt nicht übersehen werden, der 1062 als Bestandteil des Königshofes
Forchheim bezeichnet wird und zudem hinüber die Ortschaften Trubach (St.
Lorenz) die Verbindung bildeten: in Troschenreuth ist eine St. Martinskirche;
Looshorn (I. 7) meint: 'sie könnte leicht die zweitälteste Kirche des Bistums
Bamberg sein, denn wir finden um 630 die Ostfranken auf dem Zuge nach Böhmen;
auch ist in jener Gegend Frankenohe gegründet.'" (14)
 |
Nur mehr als Bild
bzw. Modell kann man
die alte Martinskirche
von Troschenreuth sehen.
Am 19. April 1945 kam es
nämlich nach Beschuss
der Ortschaft durch Amerikaner
zu einer Brandkatastrophe.
14 Wohnhäuser sowie
Kirche und Schule
wurden damals vernichtet.
In die 1949 erbaute
neue Martinskirche
kam die Inneneinrichtung
der bei der Erweiterung des
Truppenübungsplatzes
abgelösten Ortschaft
Hopfenohe.
|
Troschenreuth ist
demnach wohl die älteste christliche Gemeinde im früheren Dekanat Auerbach, von der
Looshorn weiter schreibt, dass es schon 788 einen eigenen Priester besessen habe.
Troschenreuth und Thurndorf kamen damals zum Stifte Würzburg, der Rest des heutigen
Dekanats mit z.B. Pegnitz (Paginza) und Auerbach, beide im Nordgau (in pago
Nortgowe), sowie dazu u. a. auch Lauf, Betzenstein und Hersbruck, sollten zu
Eichstätt gehören. Diese Orte bildeten den nördlichsten und entlegensten Teil
der Diözese (Eichstätt), zu der auch die "Mutterkirche" in Velden (Feldun)
gehörte, von der bis herauf zur eigenen Pfarreierhebung die religiöse und
pfarrliche Betreuung Auerbachs ebenso wie die der anderen Orte der Umgebung
durchgeführt wurden.
"Velden war die Urpfarrei für das ausgedehnte
Waldgebiet beiderseits der oberen Pegnitz, eine karolingische Königskirche, die
bereits vor dem Jahre 912 dem Bischof von Eichstätt geschenkt wurde, in dessen
Bistum sie lag." (15)
Die Marienkirche in Velden
fand erstmals im Jahr 912 n. Chr. als karolingische Königskirche urkundlich
Erwähnung.
Der Ort Velden könnte sogar schon um 730 unter dem
Bayernherzog Odilo noch vor der fränkischen Besitznahme 744 als baierischer Königshof
gegründet worden sein.
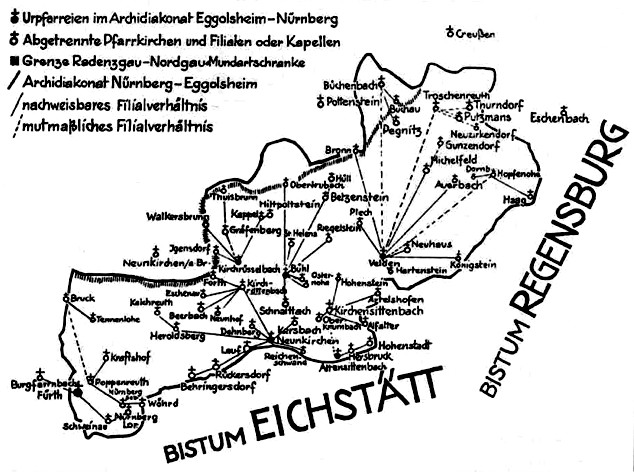
"Im
Gebiet des Veldener Forstes, also dem ursprünglichen Sprengel der Pfarrei
Velden entstanden nun nicht weniger als 15 neue Pfarreien, die sich im Laufe des
12.-17. Jahrhunderts von ihrer Mutterpfarrei trennten." (15) Für unsere nähere
Heimat seien genannt:
1121 Michelfeld
1476 Neuhaus
1144 Auerbach
1480 Königstein
vor 1430 Gunzendorf
1662 Hartenstein
Troschenreuth
und Thurndorf sind bei Schwemmer und hier bei Schnelbögl (16) ebenfalls der
"Mutterkirche" Velden zugeordnet, während Looshorn und Köstler beide
Pfarreien als älter ansehen.

verwendete und
weiterführende Quellen
| 1 |
Neubig
Johannes, Auerbach, die ehemalige Kreis und Landgerichts-Stadt, Auerbach
1836 |
| 2 |
Wolf/Tausendpfund, Pegnitz -
Veldensteiner Forst, Erlangen 1986 |
| 3 |
Rahner/Vorgrimler, Kleines
Konzilskompendium, Freiburg 1966 |
| 4 |
Köstler Joseph, Auerbachs
Kirchen- und Schulgeschichte, Band I von 27 handgeschriebenen Bänden,
Auerbach um 1900 |
| 5 |
Nöhbauer Hans, Die Chronik
Bayerns, S. 38 ff |
| 6 |
Mann Golo, Propyläen
Weltgeschichte, Band 4, S. 504 |
| 7 |
Franzen August, Kleine
Kirchengeschichte, S. 131 ff |
| 8 |
Dannheimer/Dopsch, Die
Bajuwaren, S. 283 |
| 9 |
Köstler, Joseph,
Troschenreuth, Bd. 23 S. 47 ff |
| 10 |
Hubensteiner, Benno,
Bayerische Geschichte, S. 35 ff |
| 11 |
Hausberger, Karl, Das Bistum
Regensburg, Band I, S. 7 |
| 12 |
Kötting, Bernhard, Kleine
deutsche Kirchengeschichte, S. 33 |
| 13 |
Köstler,
Joseph, Auerbachs Kirchen- und Schulgeschichte, Band I, S. 8, 92 f |
| 14 |
Schlund, Johann, Besiedelung
und Christianisierung Oberfrankens, S. 76 |
| 15 |
Schwemmer, Wilhelm, Velden a. d.
Pegnitz, S. 66 f |
| 16 |
Schnelbögl, Fritz, Auerbach
in der Oberpfalz, S. 41 |
| 17 |
Ruf, Walther, Das erste
Diakonissenhaus in Deutschland - Lioba, Mitarbeiterin des Bonifatius, in
Christus unterwegs nach Deutschland, München 1963 |
| 18 |
Baumeister, Richard u.a.,
Das Bistum Eichstätt in Geschichte und Gegenwart, Eichstätt 1991 |

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 29. Juli 2025

|
Für Ergänzungen, Korrekturen usw.
bin ich sehr dankbar.
Hier können Sie mich erreichen!
|

|

 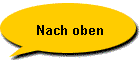
|