|
| |
Die Pfarrei Haag
Zur
Pfarrei Haag, die erst 1876 selbständig wurde, gehörten bis zur Auflösung
1938 auch die Ortschaften Bergfried,
Dorfgänlas, Dörnlasmühle, Hammergänlas und
Hebersreuth. Bis zu jenem Jahr hatte Haag ja über Jahrhunderte als Filiale zur Pfarrei Hopfenohe
gehört.
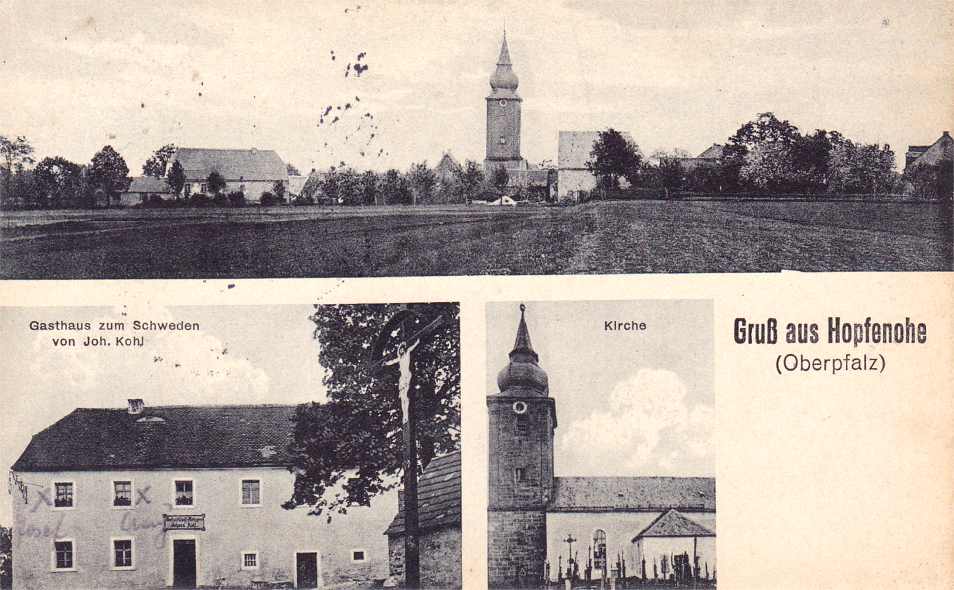
Über
Jahrhunderte gehörten die Katholiken von Haag zur Pfarrei Hopfenohe, und
hatten dort ihre Kirche und ihren Friedhof. (Foto aus 1)
Haag
und Hopfenohe
Das Verhältnis der Hocher zu ihrer Pfarrei in Hopfenohe scheint nicht
besonders gut gewesen zu sein. Josef Köstler,
dessen Bruder Franz Seraph 1866 als Kaplan von Hopfenohe Seelsorger für Haag
war, meint dazu in seiner blumigen Sprache: "Die Verbindung Haags
mit Hopfenohe war keine natürliche, und nie fühlten sich die Bewohner von Haag
hingezogen zu ihrer Pfarrkirche und nie arrangierten sie sich mit dem übrigen
Pfarrvolke. Wer die weite Entfernung beider Orte, den schlechten Weg, die hohe
Lage, das rauhe Klima und die riesigen Schneewehen, die den Kirchgang so
beschwerlich machten, kennt, wird die Abneigung der Filialisten zur Mutterkirche
begreifen. Dazu kam noch die Eitelkeit der Haager Filialisten, die als
Handwerker und Bürger sich einen höheren Rang als die Bauern einbildeten und
in der Kirche allerlei Vorrechte anstrebten. Die eitle Tochter schämte sich
ihrer bäuerlichen Mutter und suchte sich ihrer Vormundschaft möglichst zu
entziehen. Die beleidigte Mutter machte aber der arroganten Tochter keine
Konzessionen und hielt sie, wenn sie sich ungebärdig zeigte, um so straffer am
Zügel. Auf diese Weise bildete sich zwischen Sankt Peter (Anm.: Pfarrkirche in
Hopfenohe) und Sankt Veit (Anm.: Filialkirche in Haag) ein liebloses Verhältnis,
wie es oft zwischen Stiefeltern und Stiefkindern bemerkbar ist. Und wie die
Stiefkinder durch böse Nachbarn gewöhnlich auch noch gegen ihre Eltern
verhetzt werden, so wurden auch die Haager Filialisten in ihrem Widerstand gegen
Hopfenohe stets gestärkt durch die Bamberger Obrigkeit in Vilseck. Dieses Verhältnis
blieb Jahrhunderte hindurch bestehen und führte erst spät zur Trennung und zur
Selbständigmachung der Haager Kirche." (2, Seite 376)

Die Hocher hatten einen weiten Weg von gut 6
km, wenn sie in ihre Kirche nach Hopfenohe wollten. Auch die Höhenlage der
beiden Orte ist zu beachten: Haag lag 442 m über dem Meeresspiegel, Hopfenohe
dagegen gut 100 m höher auf immerhin 557 m. Wenn z.B. in Haag nur eine ganz
dünne Schneedecke lag, türmte sich das weiße Element in Hopfenohe schon fast
meterhoch auf. Hopfenohe war wegen seiner hohen Lage bekannt für sein raues
Klima und für seine schneereichen und langen Winter.
So schreibt Köstler an andrer Stelle Köstler
über die häufigen Beschwerden der Haager Gläubigen: "Unter ihren Klagen
war am berechtigtsten jedenfalls jene, die den weiten beschwerlichen Weg betonte
u. auseinandersetzte, daß wegen weiter Entfernung der Pfarrkirche u. des
Pfarrers u. wegen des im Winter unpassierbaren Weges ein Kirchbesuch, eine Taufe
oder Provisur (Anm.: Versehgang, früher auch letzte Ölung
genannt, heute Sakrament der Krankensalbung) oft wochenlang nicht möglich
sei, daß alte gebrechliche Leute monatelang keinen Gottesdienst beiwohnen können,
daß schwächliche Kinder nicht selten ohne Taufe u. sterbende Personen ohne
Wegzehrung verscheiden müssen, daß man im Winter die Leichen häufig nicht
nach Hopfenohe bringen kann u. wochenlang im Hause behalten muß u. daß sich
schon viele Filialisten auf dem Kirchenweg oder bei Leichenbegängnissen durch
den tiefen Schnee u. rauhen Wind schwere Krankheiten u. selbst den Tod zugezogen
hätten." (3, Seite 104)
Eigenes
Frühmessbenefizium 1487
Nach jahrelangem Drängen der Hocher genehmigte am 3. Oktober 1487 der Bamberger
Fürstbischof Heinrich III. Groß von Trockau (reg. 1487-1501) eine Frühmesse
in der Kapelle des hl. Veit in Haag. Erster Benefiziat wurde der Geistliche Erhard
Schmidt, der bis 1506 in Haag wirkte. Sein Nachfolger als Primissarius wurde
Erhard Faber, der das Frühmessbenefizium in Haag bis 1520 inne hatte. Der
dritte und zunächst letzte katholische Frühmessbenefiziat war dann bis 1530
Ulrich Reheböck. Wohnhaus des Benefiziaten war die Nr. 16, der spätere
Pfarrhof.
Die Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Auerbach hatte übrigens gleich
sieben Messbenefizien, die aber alle im 16.
Jahrhundert wieder untergingen.
|
Martin Luther
(1483-1546)
wollte die katholische Kirche reformieren.
Daraus wurde aber eine Kirchenspaltung.
In der Stadt Weiden fanden
die Gedanken Luthers 1522 Eingang,
Regensburg fiel 1525 von seinem Bischof ab,
und 1526 heiratete Abt Nikolaus
vom Zisterzienserkloster Waldsassen.
(Kupferstich von Lukas Cranach d. Ä., 1520)
|
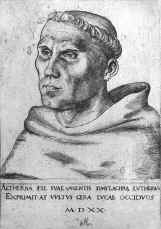 |
Verwirrende
Glaubensverhältnisse
Haag blieb der Überlieferung nach etwas länger katholisch als die umliegenden
Orte. Der erste lutherische Pfarrer von Hopfenohe, Nikolaus Schöberlein (reg.
1530-49), war zwar offiziell auch für die Haager zuständig, denn diese
gehörten nach wie vor pfarrlich zu seinen Schäflein. Allerdings fühlten sich
die Bewohner von Haag seit jeher nicht recht wohl in der Pfarrei Hopfenohe,
weshalb ja auch 1487 ein eigenes Benefizium in ihrem Dorf eingeführt worden
war.
Anno 1554 musste der Bischof von Bamberg sein Amt Vilseck, zu dem auch Haag
gehörte, an die Stadt Nürnberg verpfänden. Diese führte sofort das
lutherische Bekenntnis ein.
"1554–1627 waren insgesamt 12 lutherische oder kalvinische Geistliche in
Haag, die sich Diener am Wort Gottes und seit 1576 Pfarrer
nennen. Der Pfarrer von Hopfenohe nennt sie aber Diacone
und Frühmesser. Diese protestantischen Geistlichen
hatten einen wackeligen Standpunkt, weil sowohl Bamberg
als auch die Pfalz das Besetzungsrecht in Anspruch nahmen. Ernannte der
Vilsecker Oberamtmann einen Geistlichen, so verjagte ihn der Auerbacher
Landrichter; besetzte aber die Pfalz den Seelsorgeposten
zu Haag, entzogen die Vilsecker Behörden dem Geistlichen
viele Gehaltsteile. Eine Einigung war umso weniger zu
erzielen, als Vilseck nur lutherische, die Pfalz aber nur
kalvinische Geistliche dulden wollte.
Zum Seelsorgebezirk Haag gehörten nur die beiden Orte Haag und Bergfried, und diese
blieben mit der Taufe, der Hochzeit und dem Begräbnis bei der Mutterkirche Hopfenohe.
Erst seit 1577 durfte der Haager Diakon in der Kirche des St. Veit taufen und
ein eigenes Taufbuch führen. Anno 1614 bekam Haag auch einen eigenen Friedhof neben
der Kirche und war nun ganz und gar selbständig und von Hopfenohe unabhängig."
(4, Seite 538)
Parallel zu dem umfassenden
Glaubens- bzw. Konfessionskrieg
in der Reformationszeit
wütete bereits seit 1618 auch in unserer Heimat
der schreckliche Dreißigjährige
Krieg.
In seinem Verlauf nahm im Herbst
1621
der Führer der katholischen Liga,
Herzog Maximilian
von Bayern (Bild),
mit seinem obersten Feldherrn Tilly
die Oberpfalz für den Kaiser in Besitz. |
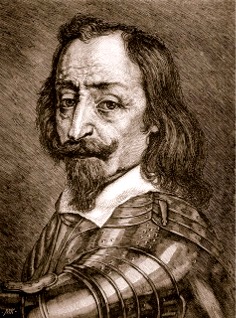 |
Maximilian,
der schon 1623 von Kaiser Ferdinand
II. (reg. 1619-37) die pfälzische Kurwürde erhalten hatte, bekam am 22.
Februar 1628 die Oberpfalz und die rechtsrheinische Unterpfalz
als Pfand für seine Kriegskosten. Ihm war sehr daran gelegen, in seinem neuen
Land möglichst schnell wieder den katholischen Glauben einzuführen.
Zentrum der Rekatholisierung unserer
Oberpfalz war die Regierungsstadt Amberg, und dort waren die Jesuiten
federführend damit beauftragt.
Hopfenohe und Haag 1626
wieder katholisch
Nach Auerbach kam 1625 Ulricus Faulmüller, dessen Bild im Chorraum der Spitalkirche
hängt, als erster katholischer Pfarrer nach fast 100 Jahren. Ein Jahr später
wurde dessen bisheriger Kaplan Georg Molitor Pfarrer in Hopfenohe, zu dem Haag
nach wie vor gehörte. Das Haager Frühmessbenefizium wurde zunächst nicht mehr
besetzt, sondern dem Pfarrer von Hopfenohe übertragen. Erst 1722 wurde ein
eigener Kaplan in Hopfenohe installiert. Diesem war dann die Seelsorge in Haag
übertragen. Da er im Pfarrhof Hopfenohe wohnte, musste er praktisch täglich
nach Haag und zurück gehen, um dort Messe zu halten, Beichte zu hören, Kranke
zu besuchen usw. Es war also sicher ein recht beschwerliches Amt, denn auch in
Hopfenohe selber hatte der Kaplan ja noch zu tun.
Unter den zahlreichen Hopfenoher Kaplänen mit Seelsorgeauftrag in Haag
waren unter anderem auch Konrad Buhr aus Hagenohe
(1835), Joseph Kormann (1839-43) aus Nasnitz und
Franz Seraph Köstler (1866) aus Auerbach.
1877 wird Haag
selbständige Pfarrei
Zum 9. Mai 1877 wurde trotz heftigen Protestes seitens des Hopfenoher Pfarrers
Johann Schmitt Haag eigenständige Pfarrei. Erster Pfarrer wurde der bisherige
Auerbacher Kaplan Johann Scherlein (reg. 1877-99). Ihm folgte Paul Unterburger
(reg. 1899-1904), der danach nach Neuhaus an der Pegnitz ging. Danach waren
Konrad Hermann (1904-13), Ernst Deinzer (1913-31), Josef Euringer (1931-36) und
Ludwig Wimplinger (1936-38).
1.jpg) |
Der letzte Pfarrer von Haag
war Ludwig Wimplinger (1936-1938),
der u. a. 1950 bis 1963 Pfarrer
in Neuhaus
an der Pegnitz war.
(Sterbebild aus 5)
|
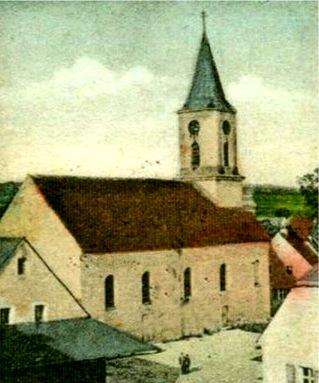
Die Kirche in Haag
Eine Kapelle gab es in Haag natürlich schon sehr früh. Wie sie aussah, ist nicht bekannt.
Schon 1487
war in Haag ja eine Frühmesse gestiftet worden, die jeweils von Benefiziaten
wahrgenommen wurde. Es muss sich also schon um eine größere Kapelle gehandelt
haben, weil sie ein eigenes Messbenefizium hatte. 1722 wurde dieses Benefizium
in eine Kaplanstelle umgewandelt, die aber weiterhin der Pfarrei Hopfenohe
zugeordnet blieb.
Die 1938 bei der Ablösung des Ortes im Zuge der Erweiterung des
Truppenübungsplatzes Grafenwöhr aufgelassene Kirche in Haag war erst 1868
durch den Bamberger Erzbischof Michael von Deinlein (reg. 1858-75) geweiht
worden.
 |
Dieser weitgehende Neubau
war Mitte des 19. Jahrhunderts
notwendig geworden,
weil bei einem Großbrand 1848 (24. Juli)
zusammen
mit 42 Wohn- und 110 Nebengebäuden
auch die alte Kirche
ein Raub der Flammen
geworden war. |
.jpg)
Über
die weiterhin dem hl. Vitus
geweihte
Pfarrkirche Haag
heißt es:
„Einfacher Bau
des 18. Jahrhunderts,
modern romanisch
nach Osten
erweitert und modern romanisch
eingerichtet.“ (6, Seite 52; Foto aus 6)
1ak.jpg)
In
diesen Ortsplan von Haag (5, Seite 105) habe ich zur besseren Orientierung die
Kirche St. Veit (HNr 40) gelb, das Pfarrhaus (HNr 16) rot, die Schule (HNr
41) grün und den Friedhof blau eingezeichnet. Das Bächlein Frankenohe fließt
hier fast diagonal von links oben (Nordwesten) nach rechts unten (Südosten).
Etwas weiter südwestlich davon lief fast parallel zur Frankenohe die
Reichsstraße 85, deren Verlauf auf dem Luftbild
noch gut zu erkennen ist.
Bei
der Kirche von Haag stand auch das Kriegerdenkmal. Es wurde nach dem Verlassen der
Ortschaft abgebrochen und in Sorghof wieder neu aufgebaut. Dort erinnert es noch
heute an die Gefallenen und Vermissten von Haag und Langenbruck.
k.jpg) |
.jpg) |
Links
das Ehrenmal an seinem alten Standort in Haag (Foto aus 8) und rechts daneben in Sorghof
(Foto aus 9).
Nach
der Absiedlung der Haager wurde die Kirche im Mai 1938 aufgelassen und
deren Einrichtung wie die Menschen in alle Winde zerstreut: die Glocken kamen
nach Johannisthal (Ortsteil
von Windischeschenbach),
das Kirchengestühl nach Michelfeld und Sassenreuth,
die Altäre und die Kanzel nach Weingarts
bei Forchheim, die Orgel nach Forth (Gemeinde Eckenthal)
und die liturgischen Geräte nach Bamberg. (nach 7, Seite 113)
|
Dieser
schlichte Granitstein
mit Kreuz
und Aufschrift
"Haag Kirche - Church
1487-1938"
erinnert heute an die
uralte Kirche
St. Vitus
in Haag. |
k.jpg) |
Der
Haager Friedhof
Wie
die Gebäudereste der einst blühenden Ortschaft verfiel auch der Friedhof von
Haag allmählich: Die Grabsteine stürzten um, wurden von Wind und Wetter
zersetzt und von der Natur überwuchert. Nicht selten werden leider auch menschliche
Unvernunft und Zerstörungswut, ja Pietätlosigkeit vor den Verstorbenen, im Spiel gewesen
sein.
Im Jahre 1992 wurde dem weiteren und endgültigen Verfall des ehemaligen Haager
Friedhofs mit vereinten Kräften
Einhalt geboten: In einer gemeinsamen Aktion des Heimatvereins Grafenwöhr, des
Bundeswehr-Verbindungskommandos (seit 1997 DMV) und des Bundesforstamtes Grafenwöhr
wurde der altehrwürdige Friedhof von Haag gleichsam "generalsaniert".

Durch
diese beispielhafte Maßnahme wurde der Friedhof von Haag der Nachwelt
erhalten. Die alten und zum großen Teil kunstvoll gehauenen Sandstein- und
Granitgrabsteine wurden wieder gesetzt, und Friedhofsmauer und Eingangstreppe
ausgebessert bzw. neu angelegt. 1997 konnte auch ein neues Friedhofskreuz
aufgestellt und geweiht werden. (Fotos 2009)
 |
Erstmals
gestattete 1992
der damalige US-Kommandeur
den Besuch
des Haager
Friedhofes.
Seither dürfen
- vor allem ehemalige Haager -
an
Allerheiligen bzw. Allerseelen
die Gräber ihrer Vorfahren
besuchen.
|
verwendete Quellen
| 1 |
Archiv Michael Hiller, Grafenwöhr |
| 2 |
Köstler, Joseph, Chronik von Hopfenohe, Band
XXV der siebenundzwanzigbändigen, handgeschriebenen Chronik, Auerbach um
1920 |
| 3 |
Köstler, Joseph, Chronik von Haag, Band XXVI
der siebenundzwanzigbändigen, handgeschriebenen Chronik, Auerbach 1920 |
| 4 |
Kugler, Hans-Jürgen, Hopfenohe - Geschichte
einer Pfarrgemeinde, Auerbach 1997 (Bezugsquelle) |
| 5 |
Archiv
Hans Winter, Rauhenstein |
| 6 |
Hager, Georg,
Die Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern,
Bezirksamt
Eschenbach,
München 1909 |
| 7 |
Griesbach, Eckehart,
Truppenübungsplatz Grafenwöhr,
Behringersdorf 1985 |
| 8 |
Archiv Armin Knauer,
Grafenwöhr |
| 9 |
Archiv
Wilhelm Ertl, Sorghof |
|
Stubenvoll, Johann, Aus der Chronik des Ortes
Haag, in Festschrift zum Wiedersehensfest der Alt-Langenbrucker u.
Alt-Haager, Sorghof 1954 |
|
|
letzte Bearbeitung dieses Artikels am 24. September
2012

|
Für Ergänzungen, Korrekturen usw.
bin ich sehr dankbar.
Hier oder unter 09643 683
können Sie mich erreichen!
|

|
 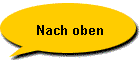 |